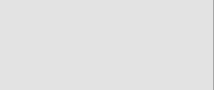
|
7'30, 26.St/16 Bericht von Propst Blarer an den Bischof von Konstanz über die seit der Reformation dem Stift entfremdeten Güter und Rechtsame und die Bemühungen des Stifts, diese zurückzuerlangen, 1583 (ca.) (Dossier)
| Ref. code: | 7'30, 26.St/16 |
| Title: | Bericht von Propst Blarer an den Bischof von Konstanz über die seit der Reformation dem Stift entfremdeten Güter und Rechtsame und die Bemühungen des Stifts, diese zurückzuerlangen |
| Preview: |
|
| Rechtsakt-Typ: | Prozesseinlage |
| Überlieferungsform: | Konzept/Vorurkunde |
| Creation date(s): | approx. 1583 |
| Ausstellungsdatum: | vgl. Kommentar |
| Aussteller: | Johann Jakob Blarer von Wartensee, Domherr des Hochstifts Konstanz und derzeit Propst und Stiftsherr zu Bischofszell |
| Adressat: | (Mark Sittich von Hohenems) Kardinalbischof von Konstanz |
| Regest: | Johann Jakob Blarer von Wartensee [Blarrer vonn Warttense] führt beim Kardinalbischof von Konstanz (Mark Sittich von Hohenems) Klage über die seit der Reformation in Bischofszell eingetretene Schädigung der Rechte und Güter des Stifts:
1. Als nach der Reformation [der empörung gloubens halber] die Lutherischen, "wie man sy nempt", in der Stadt Bischofszell und in der Landgrafschft Thurgau fast überall die Oberhand gewonnen hatten, sind Kirchenzierden im Wert von über 6000 Gulden ("von iren predicanten selbst also geschätzt") zerstört, hölzerne Heiligenbildnisse verbrannt und die hübsche Pfarrkirche, die im Chor und ausserhalb des Chors gar anmutig und schön [gar lustig und schön] bemalt und verziert war, wie es der Augenschein noch erahnen lässt [wie es der ougenschin noch sächen last], übertüncht [verstrichen] und 13 Altäre abgebrochen und verbrannt worden. Auch die Pfründen sind alle behändigt worden und das Stift ist vollständig unter ihre Gewalt geraten. Nach dem Sieg der fünf alten katholischen Orte in der Schlacht auf dem (Zuger) Berg [schlacht uff dem berg] sind durch den Landfrieden fast alle Zinsen und Zehnten dem Stift restituiert [widerumb zugestelt] worden. Die Pfarrgült und andere Pfründen und Kaplaneien konnten die Protestanten jedoch behalten, wie ihnen unter dem Druck der immer noch unruhigen Zeiten in einem Urteil, dessen Abschrift unter A beiliegt, notgedrungenermassen zugestanden wurde. Sieben abtrünnige [abfellige] Chorherren und Kapläne mussten aus den Stiftseinkünften bis zu deren Tod geduldet und ausgehalten werden. Erst darauf haben die Eidgenossen auch die Restitution der Altar- und Kaplaneipfründen durchgesetzt und erreicht, dass die Lutherischen [lutterischen] für ihre Prädikanten eigenen Stiftungen aufrichten müssen. So konnte auch die von den Neugläubigen [nüwglöübigen] in ihre Gewalt gebrachte Pfarrkirche von Sulgen samt deren Einkommen wieder der Jurisdiktion des Stifts als des althergebrachten Kollaturherrn dieser Kirche unterstellt werden. Da die Neugläubigen aber mehr als neun Zehntel der Bevölkerung dieser Pfarrei ausmachen, wurde ihnen ein Prädikant zugestanden.
2. Ebenso haben die Neugläubigen die beiden Fililalkirchen in Neukirch an der Thur [Selischwyl oder Nüwen Kilchen genant] in der Herrschaft Schönenberg und zu Berg mit all ihren Einkünften in ihre Hände gebracht. Aber anno 1566 konnte das Stift auf der Grundlage eines eidg. Abschieds diese Filialkirchen den Bauern wiederum entreissen [widerumb den puren aberhalten] und mit Messpriestern versehen, denen die Dotation nun vorbehalten ist. Wenn die von Schönenberg und Buhwil einen Prädikanten wünschen, müssen sie ihn selbst finanzieren. Ebenso wird es jetzt in Berg gehalten. Darauf hat das Stift versucht, auch die Pfarrpfründen in den Händen der Neugläubigen in Bischofszell wieder zurückzuerlangen, was diese mit Verweis auf den Landfrieden und besagten, "inn der unrüweigen zitt" gemachten Vertrag bisher verhindern konnten. Anno 1563 ist es deswegen zu einem gütlichen Vergleich zwischen beiden Parteien gekommen, der einen jährlichen Beitrag von 4 Mutt Kernen, 1 Malter Haber und 1 Gulden ab der Pfarrpfründe an das Stift beinhaltet (Abschrift C), "welliches gar ein rings, spöttlichs unnd kleinfüegigs ist". Angesichts der Tatsache, dass der Leutpriester des Stifts "viel meer labores, müehe und arbeit" hat als ein Prädikant, da er nicht allein predigen, sondern auch im täglichen Chorgebet mitwirken, die Kranken besuchen und trösten, die Kranken und Gesunden unterrichten und mit den heiligen Sakramenten versehen und die wöchentlichen Jahrzeiten halten muss, wäre angebracht, dass man die vom Bischof gestiftete Pfarrpfründe voll und ganz den Neugläubigen entreissen und wieder dem Stift zukommen lassen würde. |
| (3.) Nachdem diese Forderung durch das Stift vor die Tagsatzung gebracht worden war, hat ein eidgenössischer Abschied von 1567 (Abschrift B) vier Schiedleute zur Vermittlung eines Vergleichs bestellt, nämlich Schultheiss Pfyffer von Luzern und Landammann Ab Yberg von Schwyz für die Partei des Stifts und Bürgermeister von Cham von Zürich sowie Landammann Schuler von Glarus für die Partei der Stadt Bischofszell, die sich auf Sonntag, den 19. Oktober 1567 in Bischofszell versammeln sollten. Da sowohl von Cham als auch Pfyffer verhindert waren, haben sich beide Parteien vorläufig geeinigt, worauf alles gleich oder noch schlimmer [glich oder noch spöttlicher und schimpflicher] geworden ist. Dies ist auch auf das ungetreue und schimpfliche Haushalten des alten Propstes Kyd und seines Kustors, Blarers Vetter [min vetter], zurückzuführen.
Verlangt wird, dass die Prädikanten den Propst als ihren Lehensherren anerkennen, ihm präsentiert und von ihm formell investiert werden. Räte und Bürger sollen ferner die Rosenkranz-Gült und die Allerseelen-Pfründe, die der abgefallene Priester und spätere Prädikant Jakob Last bis zu dessen Tod innehatte, zurückerstatten.
4. Dieser Artikel betrifft ein rechtlich unbestrittenes Lehengut.
5. Schulgült: Hier soll es bei der hälftigen Teilung der Zinsen und Zehnten laut darüber aufgerichtetem Vertrag bleiben.
6. Die Räte sollen das Geld für das Ewige Licht und das Öl dazu [das amppellen unnd öll-gelt] wie bisher jährlich dem Mesmer ausrichten.
7. Die Räte verzichten auf ihre Ansprüche auf den Pfarrkrautgarten. Incipit und Explicit des Vertrags vom 05.09.1567 (enthaltend die zuvor genannten Streitpunkte) sind inseriert.
Propst Blarer kommt auf weitere Forderungen zu sprechen, so auf die nach ordentlicher Präsentation der evangelischen Geistlichen vor dem Propst (vgl. Kommentar) oder nach der Rückgabe der von Waldburga Henseler gestifteten Pfründe. Schliesslich spricht er Rat und Bürgern von Bischofszell ab, sich auf den (2.) Landfrieden berufen zu können, da Bischofszell dem Fürstbischof gehöre und sich der Landfriede nur auf die gemeinen Ämter und Vogteien beziehe, während "nit allein inn einer loblichen Eydtgnosschafft, sonder ouch usserthalb im rych unnd allen andern nationen" der Grundsatz gelte, dass die Untertanen der Obrigkeit auch im Glauben und anderen Dingen gehorsam zu sein haben. |
| Dorsualvermerk: | Fürtrag unnd bericht der pfrünnden halben zů Bischoffzell.
1585. |
| Sprachen: | Deutsch |
| Beschreibstoff: | Papier, fadengeheftet |
| Anzahl Blätter: | 10 |
| Format B x H in cm: | 22.0 x 34.0 |
| Siegel und andere Beglaubigungsmittel: | Unbeglaubigt, undatiert |
| Kommentar des Staatsarchivs: | Dem sich selbst als "artickel oder fürtrag" bezeichnenden Text fehlen sowohl eine formelle Intitulatio wie Grussformel, Datierung, Unterschrift oder Besieglung. Es ist eine Klageschrift und zugleich Kommentar und Begleitschrift zu abschriftlich eingereichten Urkunden, welche die Klagepunkte belegen sollen. Formal gleicht das Dokument einer sauberen Abschrift ohne Ergänzungen oder Korrekturen von erster Hand. Eine zweite Hand hat jedoch mehr als sechs Jahre nach der Abfassung einzelne Ergänzungen, Streichungen und Korrekturen angebracht, so beim Satz S. 12: "so bin ich, der jetzit probst, jetzt vier (ersetzt durch: mer dan 10 jar) jar probst, sind zwen (ersetzt durch: vier) predicanten, die sy pfarrer nennen und heißen, alda gwesen". Dies gibt Anhaltspunkte für die Datierung. Wenn wir mit Kundert (HS II/2, S. 237) davon ausgehen, dass Blarer im Juli 1579 sein Amt in Bischofszell antreten konnte, so kann man die Klageschrift in die zweite Hälfte des Jahres 1582 oder in die erste Hälfte des Jahres 1583 stellen. Blarer, der sich an dieser Stelle darüber beklagt, dass die neu eingesetzten Prädikanten ihm nicht ordnungsgemäss präsentiert würden, konnte 1583 tatsächlich die Installierung zweier evangelischer Geistlicher erlebt haben: jene des Pfarrers Georg Sulzer 1582 und die des Diakons Stephan Strupler 1583. 1592, also deutlich mehr als 10 Jahre nach seinem Amtsantritt waren es dann vier solche Einsetzungen, da 1594 die von Heinrich Steiner und 1592 die von Johannes Walther als Pfarrer dazugekommen waren (Sulzberger, Verzeichnis der Geistlichen, S. 153 u. 158). Aus den nachträglichen Aktualisierungen könnte geschlossen werden, dass die ursprünglich an Bischof Mark Sittich von Hohenems (1561-1589) gerichtete Klageschrift etwa 1592 gegenüber dessen Nachfolger Bischofs Andreas von Österreich (1589-1600) erneuert worden ist.
Zum ehemaligen Chorherrn und späteren Prädikanten in Bischofszell, Neukirch und Heiligkreuz Jakob Last (+ 1575), laut diesem Dokument Inhaber der Allerseelen-Pfründe, laut Sulzberger Inhaber der Michaelipfründe, vgl. auch Sulzberger, Verzeichnis der Geistlichen, S. 158 und 173.
Zum 2. Kappelerkrieg, auf den hier nicht in Form der Schlacht bei Kappel vom 11.10.1531, sondern durch die Erwähnung der zweiten und tatsächlich entscheidenden Schlacht am Zugerberg vom 24./25.10.1531 angespielt wird, vgl. HLS 7, S. 93.
Dieser Bericht Blarers stellt ein eindrückliches Dokument der Gegenreformation dar, wie sie nach dem Konzil von Trient (auf das ausdrücklich Bezug genommen wird) durch diesen Propst betrieben wurde. Blarer kritisiert in scharfen Worten alle gütlichen Einigungen zwischen Stift und Stadt und verlangt gegen Ende seines Berichts nichts weniger als die vollständige Rückkehr der evangelischen Mehrheit in der Stadt zum katholischen Bekenntnis, da Bischofszell nicht unter die Landfriedensbestimmungen zur konfessionellen Parität falle, sondern als Stadt des Fürstbischofs gemäss dem Prinzip "cuius regio eius religio" dessen Religion anzunehmen habe. |
| Alte Signaturen: | Signaturen vor 1770/71: <16 (auf Rasur)>; LL; ST
Pupikofersche Signatur (1848): St 16
Chronologisches Urkundenverzeichnis (1888/96): -
Zettelrepertorium (1937): 7'30'26 |
| Level: | Dossier |
| Ausprägung bei Ablieferung ans Staatsarchiv: | analog |
| Konservierung/Restaurierung: | Nachgeleimt; Risse/Fehlstellen geschlossen; trockengereinigt; wässrig entsäuert (2023). |
| |
Containers |
| Number: | 1 |
| |
Files |
| Files: | |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1603 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | uneingeschränkt |
| Accessibility: | Oeffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: |  https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=438302 https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=438302 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |
|