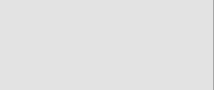
|
8'418 Frauenfeld-Wil-Bahn (1887-2002), 1887-2002 (Hauptfonds)
Identifikation |
| Ref. code: | 8'418 |
| Title: | Frauenfeld-Wil-Bahn (1887-2002) |
| Creation date(s): | 1887 - 2002 |
| Entstehungszeitraum, Streudaten: | 1870 - 2010 |
| Level: | Hauptfonds |
Umfang |
| Running meters: | 24.00 |
| Number: | 217 |
|
|
Kontext |
| Name der Provenienzstelle: | Frauenfeld-Wil-Bahn (FW), Mittel-Thurgau-Bahn (MThB), Appenzellerbahnen (AB)
|
| Verwaltungsgeschichte/Biografische Angaben: | Gründung
In den Dörfern zwischen Wil SG und Frauenfeld hatten sich schon früh Textilindustriebetriebe angesiedelt, die vor allem Anschluss in Richtung St.Gallen suchten, einem wichtigen Zentrum der damaligen Textilindustrie. So kamen schon kurz nach dem Bau der beiden Bahnstrecken Winterthur-Romanshorn und Winterthur-St. Gallen im Jahr 1855 Ideen einer Bahnverbindung zwischen Wil und Frauenfeld auf. Von einem Normalspurprojekt Wil-Frauenfeld-Stammheim wurde im Jahr 1875 schliesslich abgesehen. Doch verstärkte sich anschliessend die Idee einer Schmalspurbahn entlang der Landstrasse; damit sollten auch Landerwerbskosten gespart werden. Am 14. Dezember 1879 fand in Eschlikon eine Versammlung der Gesellschaft Hinterthurgau statt, bei der Staatsschreiber Emil Kollbrunner über eine Strasseneisenbahn Wil-Frauenfeld referierte. Am 16. Februar 1880 trafen sich die Mitglieder des Initiativkomitees zu einer ersten Sitzung in Wil, Präsident war Johann Philipp Heitz von Münchwilen. Ingenieur Jakob Ehrensperger in Winterthur wurde beauftragt, ein Projekt und einen Kostenvoranschlag für eine Schmalspurbahn zwischen Frauenfeld und Wil auszuarbeiten. Dieser ging im Jahr 1881 von Baukosten von einer halben Million Franken aus. Mit der Thurgauer Regierung wurde ein Vertrag über die Mitbenützung der Landstrasse abgeschlossen und 1884 beschloss der Grosse Rat eine Aktienübernahme von 45'000 Franken. Im Sommer desselben Jahres erteilten die Eidgenössischen Räte eine auf dreissig Jahre befristete Konzession für eine "Strasseneisenbahn" Frauenfeld-Wil zuhanden einer noch zu gründenden Aktiengesellschaft. Das Aufbringen von Kapital bei Kantonen und Gemeinden erwies sich als schwierig. Schliesslich konnten im Laufe des Jahres 1886 mit drei Firmen Verträge abgeschlossen werden, die für einen Pauschalbetrag von 600'000 Franken den Bau und den Fahrzeugpark erstellten. Es waren dies die Berner Bahnbaufirma Pümpin, Herzog & Co., die Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM), Winterthur, sowie die Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG), Neuhausen am Rheinfall.
Bau
Nach der konstituierenden Versammlung der Aktionäre am 24. November 1886 wurde der Bau möglich und verwirklicht. Mitte April 1887 konnte mit dem Bau begonnen werden, der innerhalb von nur viereinhalb Monaten vollendet wurde, sodass am 1. September 1887 die Strecke eröffnet werden konnte.
Betrieb
15 Festangestellte bildeten den Personalbestand: der Betriebsleiter, ein Oberlokführer, zwei Lokomotivführer und drei Heizer, zwei Zugführer und ein Zugführergehilfe, ein vollamtlicher Stationsvorstand, drei Streckenaufseher und ein Hilfsarbeiter. Bei Bedarf wurden Tagelöhner beigezogen und angestellt.
Drei dreiachsige Dampflokomotiven der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik wurden angeschafft, im Jahr 1890 kam eine vierte Lokomotive dazu. Sie trugen die Bezeichnungen "Frauenfeld", "Wyl", "Murg" und "Hörnli". 1907 musste eine weitere Lokomotive gekauft werden, die "Landskron" - von der unterdessen elektrifizierten Birsigtalbahn.
Während des Eidgenössischen Schützenfestes 1890 in Frauenfeld war die Frauenfeld-Wil-Bahn gefordert. Mit einem stündlichen Taktfahrplan, mit dem Einsatz des gesamten Rollmaterials und vielen Extrazügen konnte das Verkehrsaufkommen einigermassen bewältigt werden. Eine ähnliche Situation ergab sich 1903 während der Schweizerischen Landwirtschaftlichen Ausstellung in Frauenfeld, bei der sogar noch mehr Passagiere befördert werden mussten. Sämtliche 22 Güterwagen wurden auch für Personentransporte benutzt.
|
| 1895 wurde die Dienstalterskasse verwirklicht und aus der bisherigen "Hülfs- und Krankenkasse" wurde die Krankenkasse der Linienarbeiter. 1945 folgte der Übergang zur Pensionskasse Ascoop.
Das Depotgebäude mit Werkstätten wurde 1897/98 beim Frauenfelder Stadtbahnhof errichtet und erfüllte bei zwar bescheidenen Platzverhältnissen seinen Dienst bis 1985. Die Verwaltung war im gegenüberliegenden Gebäude, der ehemaligen "Rotfarb", untergebracht. Etwas ausserhalb von Frauenfeld befand sich das "Ölmagazin", das als Lagerstätte für Depot und Baudienst diente. Auch in Wil gab es eine Lok- und Wagenremise. Im Zuge der Neugestaltung des Bahnhofs Wil wurde 1985 ein neues Depotgebäude errichtet und das Frauenfelder Depot stillgelegt und später abgebrochen.
Elektrifizierung
Über die Elektrifizierung der Bahn wurde schon kurz nach der Jahrhundertwende erstmals nachgedacht. Das Beispiel der 1903 eröffneten Strecke St. Gallen-Trogen löste solche Bestrebungen aus. Nach dem 1. Weltkrieg, als die Kohlepreise um ein Mehrfaches höher waren und die Dampflokomotiven schon mehr als 30 Jahre in Betrieb standen, musste der Entscheid fallen, entweder den Bahnbetrieb einzustellen oder mit einer grossen Investition zu modernisieren. Der Verwaltungsratspräsident Alexander Otto Aepli und der Betriebsdirektor Heinrich Hürlimann waren die treibenden Kräfte. Im August 1921 konnte die Finanzierung der elektrischen Anlagen gesichert werden, sodass bereits Anfang 1922 der elektrische Betrieb aufgenommen werden konnte. 4 Triebwagen der Wagonfabrik Schlieren wurden angeschafft, zum Preis von je 180'000 Franken. Immer wieder wurden auch weitere Triebwagen eingesetzt, die teils nur vorübergehend bei der Frauenfeld-Wil-Bahn im Dienst standen. 1969 wurden drei Triebwagen der Bremgarten-Dietikon-Bahn (BD) übernommen, um den Verlust von zwei verunfallten Triebwagen zu kompensieren. Sie erhielten die Nummern 204–206 und versahen den Dienst, bis sie 1985 von fünf neuen Pendelzügen, die in Altenrhein gebaut worden waren, abgelöst wurden. 1992 kamen zwei weitere baugleiche Pendelzüge dazu.
Güterverkehr
Beim Güterverkehr war schon in den 1920er-Jahren vorgesehen, Rollschemel einzusetzen, mit denen normalspurige Güterwagen transportiert werden könnten, damit der Güterumlad entfallen würde. Um die nicht direkt an der Bahnlinie liegenden Orte zu erreichen, schlug Heinrich Hürlimann einen Güterverteildienst mit Lastwagen vor. Doch beide Ideen gelangten nicht zur Ausführung.
Verschiedene Anschlussgleise zu Firmen wurden erstellt: in Münchwilen zur Möbelfabrik, in Rosental zur Maismühle und zur Zwirnerei, in Wängi zur Firma Stierlin & Schweitzer (später Weberei) und zum Riolgawerk, in Jakobstal zur Weberei, in Matzingen zur Mühle und zur Spinnerei und in der Murkart zur Spinnerei. Die meisten dieser Anschlüsse wurden während der ersten 20 Betriebsjahre erstellt.
Erst 1977 wurde die Möglichkeit geschaffen, mit Hilfe des Rollbockbetriebs, normalspurige Güterwagen auf Rollschemeln zu den einzelnen Firmen zu befördern. Im immer dichteren Fahrplan der Personenzüge in den 1990er-Jahren wurde es zusehends schwieriger, Güterzüge zu führen. Zudem fanden im Güterverkehr auch Veränderungen statt, der regionale Stückgut- und Einzelwagenladungsverkehr wurde vermehrt von Lastwagen übernommen, die Bahn legte ihr Schwergewicht auf Ganz- und Blockzüge und auf Transporte über lange Strecken. So wurde der Güterverkehr bei der Frauenfeld-Wil-Bahn im Jahr 1999 gänzlich eingestellt und die meisten der Anschlussgleise wurden sukkzessive zurückgebaut.
|
| Bahn oder Bus?
Diese Frage ist beinahe so alt wie die Frauenfeld-Wil-Bahn selbst. Bereits vor dem 1. Weltkrieg und in den 1930er-Jahren während der Wirtschaftskrise wurde eifrig über die Weiterführung des Bahnbetriebs diskutiert. Auch als um 1950 eine Phase einsetzte, in der viele kleinere Nebenbahnen durch Autobus- und Postautokurse ersetzt wurden, flammte diese Diskussion wieder auf. Eine Expertengruppe wurde eingesetzt, die zum Schluss kam, den Bahnbetrieb aufrecht zu erhalten und die Bahn zu modernisieren. Dieselbe Expertengruppe stellte auch für die Mittel-Thurgau-Bahn 1951 ein entsprechendes Gutachten mit dem gleichen Ergebnis aus. 1969 schlug das Institut für Orts- und Regionalplanung der Eidg. Technischen Hochschule (ETH) Zürich vor, die Frauenfeld-Wil-Bahn durch einen Strassentransportdienst zu ersetzen und mit dem gewonnenen Platz die Strasse auszubauen. Schliesslich half die Erdölkrise von 1973 den Befürwortern des Bahnbetriebs, sodass ein grösseres Investitionsprogramm ausgelöst wurde, mit dem die Gleisanlagen und die Strassenübergänge ausgebaut und verbessert wurden. Als schliesslich 1985 die über 60 Jahre lang in Betrieb stehenden elektrischen Triebwagen durch modernes Wagenmaterial ersetzt wurden, war die Diskussion vorerst vom Tisch.
Trasseeveränderungen
Beim Bau der Mittel-Thurgau-Bahn im Jahr 1911 musste das Trassee der Frauenfeld-Wil-Bahn westlich des Bahnhofs Wil verlegt werden. So wurde für die Frauenfeld-Wil-Bahn und die SBB-Strecke Wil-Winterthur eine einzige Überführung über die MThB gebaut. Eine markante Änderung des Trassees musste 1968 vorgenommen werden. Die westliche Ausfahrt aus dem Bahnhof Wil wurde so angepasst, dass die FW parallel zur SBB-Strecke Wil-Winterthur direkt bis zur neuen Autobahn N1 führte und dieser entlang bis zum Schweizerhof folgte, um von dort aus wieder das alte Trassee an der Hauptstrasse zu benützen. Kleinere Anpassungen von Gleisabschnitten kamen bei baulichen Veränderungen entlang der Strecke an verschiedenen Orten vor.
Verwaltungsgemeinschaft mit der Mittel-Thurgau-Bahn (MThB)
Im Jahr 1969 wurden die Verwaltungen dieser beiden Bahnen provisorisch, 1970 definitiv zusammengelegt. Diese Verwaltungsgemeinschaft blieb bis zum Konkurs der MThB im Jahr 2002 bestehen. Danach übernahm die Appenzellerbahn (AB) die Verwaltung der FW.
Drei Mitglieder des Verwaltungsrates bildeten jeweils die Direktionskommission.
Verwaltungsratspräsidenten
1887-1896 Schweitzer C. Albert, Fabrikant, Wängi
1897-1898 Koch Josef Anton, Nationalrat, Frauenfeld
1898-1911 Wild August, Regierungsrat, Frauenfeld
1911-1921 Aepli Alexander Otto, Regierungsrat/Ständerat, Frauenfeld
1921-1950 Halter Karl, Gemeindeammann, Frauenfeld
1950-1965 Müller Jakob, Ständerat, Frauenfeld
1966-1985 Ballmoos Walter, Regierungsrat, Frauenfeld
1985-2002 Bachofner Hans, Stadtammann, Frauenfeld
Betriebsdirektoren
1887 1919 Ammann Adolf, Oberst, Frauenfeld
1919-1961 Hürlimann Heinrich, Elektroingenieur, Frauenfeld
1961-1967 Nell Josef, Ingenieur, Weinfelden
1967-1988 Sax Rolf, Dr. rer. pol., Weinfelden
1988-2002 Joss Peter, lic. jur., Weinfelden |
| Bestandsgeschichte: | Es ist anzunehmen, dass sich das Archiv zuerst bei der Verwaltung der Frauenfeld-Wil-Bahn in Frauenfeld befand. Nach der Zusammenlegung der Verwaltungen von MThB und FW im Jahr 1969 wurde es vermutlich nach Weinfelden verbracht. Angaben darüber liessen sich jedoch keine finden.
Nach dem Konkurs der MThB im Jahr 2002 wurde die Übergabe des MThB-Archivs ans Staatsarchiv Thurgau in die Wege geleitet. Mit der Ablieferung 2002–081 im Dezember 2002 wurden die Archive der MThB und der FW in Weinfelden übernommen.
Die mengenmässig grössere Ablieferung übernahm das Staatsarchiv Thurgau von den Appenzeller Bahnen, Herisau, im Juni 2010. Darin enthalten waren in erster Linie Buchhaltung, Fotos, Dias, grossformatige Abzüge mit Eisenbahnmotiven. Diese Archivalien befanden sich bei den Frauenfelder Werkbetrieben an der Gaswerkstrasse 13 in Frauenfeld.
In der Ablieferung 2012–022, die hauptsächlich Akten der in Konkurs gegangenen Mittel-Thurgau-Bahn (MThB) enthielt und von der Firma René Bock Consulting GmbH in Weinfelden übernommen wurde (früher Thalmann Treuhand AG, Weinfelden), befanden sich ebenfalls Akten der Frauenfeld-Wil-Bahn.
Die Ablieferung 2015-025 aus dem Depot Wil enthielt viele Pläne und Typenskizzen der ältesten elektrischen Triebfahrzeuge sowie der 1985 in Betrieb genommenen Pendelzüge. Nach Aussagen des Depotleiters waren viele dieser Akten aus dem im Jahr 1985 stillgelegten Depot Frauenfeld nach Wil gebracht worden. Direktionsakten der Jahre 1997-2002, die im Jahr 2002 von den Appenzellerbahnen übernommen worden waren, befanden sich bei der Direktion in Herisau und wurden ebenfalls abgeliefert.
|
| Aus der Gründungszeit sind recht viele Akten überliefert, die ältesten gehen in die Zeit vor der Bildung eines Initiativkomitees zurück. Die Korrespondenz des Initiativkomitees scheint ziemlich umfassend vorhanden zu sein. Auch nach der Gründungsversammlung setzt sich ein reicher Bestand an Korrespondenz des Verwaltungsrates und der Direktion fort. Nach Beendigung des Baus und den ersten Betriebsjahren nimmt die Menge an Korrespondenz deutlich ab.
Pläne und Blaupausen der Streckenführung zeigen Details des Streckenverlaufs. Über die Stationsgebäude sind wenige Unterlagen oder Pläne vorhanden. Das Stationsgebäude Wängi ist besser dokumentiert und könnte exemplarischen Wert erhalten, da die übrigen Stationsgebäude in Münchwilen, Rosental und Matzingen im ähnlichen Stil gebaut worden waren.
Geschäftsberichte und Jahresrechnungen sind vollständig vorhanden. Auch bei den Protokollen des Verwaltungsrats und der Direktion scheint über den ganzen Zeitraum das meiste vorhanden zu sein. Gutachten über den Weiterbestand der Bahn wurden 1925, 1934, 1951, 1969 und 1973 erstellt und sind im Bestand. Dienstvorschriften sind ab ca. 1960 vorhanden, zudem Weisungen im Zusammenhang mit der Kriegsmobilmachung während des 2. Weltkriegs.
Bei den folgenden Akten ist die Vollständigkeit kaum abzuschätzen: bei den vorhandenen Verträgen, bei Akten zu Landerwerb, Grund und Boden, bei der Elektrifizierung sowie bei Jubiläen und besonderen Ereignissen.
Bände mit Rechnungsbelegen sind aus der Anfangszeit und aus den 1990er-Jahren vorhanden. Und zwar die folgenden Jahrgänge: 1890–1891, 1893–1900, 1901–1904, 1906–1907, 1909–1910, 1913, 1915, 1918, 1928, insgesamt rund zweieinhalb Laufmeter. Bauabrechnungen sind ca. ab den 1960er-Jahren vorhanden. Es fällt auf, dass im Bereich Rechnungswesen zwischen den Jahren 1930 und 1990 wenig Akten überliefert sind.
Mitarbeiterdossiers sind praktisch keine vorhanden.
Der Bestand wurde 2015 in rund 940 Stunden von Christof Sauter und der Abteilung Bestandserhaltung bearbeitet. |
|
Inhalt und innere Ordnung |
| Bewertung und Kassation: | Bei den Rechnungsbelegen fiel auf, dass nach 1928 offenbar keine Belege mehr längerfristig aufbewahrt wurden. Das Staatsarchiv entschloss sich deshalb, alle älteren Belege aufzubewahren und von den Belegen der letzten zehn Jahre 1992–2001 den ersten und den letzten Jahrgang zu archivieren, die übrigen aber kassieren.
Krankenkassenabrechnungen 1991–1995 und Krankenkassenprämienlisten 1996 wurden kassiert.
SUVA, erledigte Unfälle 1983–1991: Nur die Betriebsunfälle wurden archiviert.
Rundschreiben des Bundesamtes für Verkehr (Eidg. Amt für Verkehr) ohne direkten Bezug zur Frauenfeld-Wil-Bahn wurden kassiert.
Die wenigen Akten des Verkehrs- und Schützenvereins Frauenfeld (Transferprotokoll 2015-004) wurden dem Stadtarchiv Frauenfeld übergeben, da das Archiv des Verkehrsvereins beim Brand des Gebäudes "Rotfarb" vor einigen Jahren zerstört worden war.
Typenzeichnungen für Fahrzeuge anderer Bahngesellschaften wurden kassiert.
|
|
Zugangs- und Benutzungsbedingungen: |
| Rechtsstatus: | Eigentum des Staatsarchivs des Kantons Thurgau.
|
| Zitiervorschlag: | Fussnote: StATG 8'418, */*
Quellenverzeichnis: StATG 8'418 Frauenfeld-Wil-Bahn, 1887–2002
|
| Sprachen: | Deutsch, Französisch.
|
|
Sachverwandte Unterlagen: |
| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | StATG 4'15 Frauenfeld-Wil-Bahn
StATG 8'414 Mittel-Thurgau-Bahn 1911–2002
StATG 8'415 Reisebüro Mittelthurgau AG 1969-2001
|
| Veröffentlichungen: | Hürlimann, Heinrich: Aus der Geschichte einer Sekundärbahn, Frauenfeld 1942.
Sax, Rolf; Gamper, Robert: Die moderne Frauenfeld-Wil-Bahn, 1985.
Waldburger, Hans: Die Frauenfeld-Wil-Bahn, Geschichte einer Regionalbahn von 1887–1987, Luzern 1987.
Müller, Stephan: Frauenfeld - Leben, Schiene und Strasse, aus Anlass des Jubiläums 100 Jahre Frauenfeld-Wil-Bahn, Frauenfeld, 1987.
|
|
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/2022 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | uneingeschränkt |
| Accessibility: | Oeffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: |  https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=546687 https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=546687 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |
|