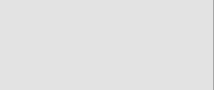
|
8'428 Bodenseeschifffahrt der Schweizerischen Bundesbahnen (1850-1993), 1850-1993 (Hauptfonds)
Identifikation |
| Ref. code: | 8'428 |
| Title: | Bodenseeschifffahrt der Schweizerischen Bundesbahnen (1850-1993) |
| Creation date(s): | 1850 - 1993 |
| Level: | Hauptfonds |
Umfang |
| Running meters: | 12.00 |
| Number: | 1674 |
|
|
Kontext |
| Name der Provenienzstelle: | Schweizerischen Bodensee-Schiffahrtsgesellschaft SBS
|
| Verwaltungsgeschichte/Biografische Angaben: | 1824 begann mit dem Dampfschiff Wilhelm der Friedrichshafener Dampfboot-Gesellschaft, das zwischen Friedrichshafen und Rorschach verkehrte, auf dem Bodensee das Zeitalter der Dampfschiffe mit einem regelmässigen Schiffsverkehr. Grundsätzlich galt zu Beginn des 19. Jahrhunderts die freie Schifffahrt auf dem Bodensee, doch zahlreiche Beschränkungen durch Schifffahrtsprivilegien (z.B. das Erheben von Abfuhrgeldern oder Zöllen) der angrenzenden Länder und Ortschaften standen dem bald entgegen. Darum lud der Schweizerische Bundesrat die Regierungen der anderen Uferstaaten zur gemeinsamen Regelung der Verhältnisse der Bodenseeschifffahrt ein. Die verschiedenen Schifffahrtsgesellschaften lieferten sich derweil einen harten Konkurrenzkampf und die Bodenseeschifffahrt büsste an Ansehen ein, wenn zum Beispiel verschiedene Strecken doppelt befahren wurden oder Passagiere der einen Gesellschaft auf der Rückreise keine andere benutzen durften.
Eine erste Massnahme zur Verbesserung war ein gemeinsamer Fahrplan, der 1847 eingeführt wurde. Mit dem Zusammenschluss der Schifffahrtsverwaltungen in den 1860er Jahren wurden dann verschiedene Abkommen und Vereinbarungen möglich, die den Schiffsbetrieb auf dem Bodensee weiter vereinfachten.
Schifffahrtsgesellschaften und ihre Zusammenarbeit
1850 wurde die "Schweizerische Dampfboot AG für den Rhein und Bodensee" in Schaffhausen gegründet, die in den darauffolgenden vier Jahren vier Dampfschiffe in Betrieb nahm. 1854 gründete die Schweizerische Nordostbahn-Gesellschaft NOB die NOB-Schifffahrt. Am 1. Januar 1857 übernahm die NOB-Schifffahrt die Dampfboot AG und unterstellte den Dampfschiffbetrieb einer speziellen Dampfschiffverwaltung mit Sitz in Romanshorn. In der Folge setzte die NOB die Schiffe der Dampfboot AG auf dem Bodensee ein und hörte im Jahr 1863 mit dem Schiffsbetrieb auf dem Rhein ganz auf. Um wieder einen Schiffsbetrieb auf dem Untersee und Rhein aufzubauen, wurde 1864 die "Gesellschaft für Dampfschiffahrt auf dem Untersee und Rhein" gegründet, die 1936 in "Schweizerische Schiffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein AG (URh)" umbenannt wurde.
Auf internationaler Ebene entwickelte sich ab 1860 eine systematische Zusammenarbeit im Bereich der Bodensee-Dampfschifffahrt in Form von Konferenzen der Vereinigten Dampfschiff-Anstalten. Ab 1874 (1879?) nannte sich die Verbindung "Vereinigte Dampfschifffahrts-Verwaltungen". Daran beteiligt waren zunächst die Schweizerische Nordostbahn-Gesellschaft, die Königlich Württembergischen Staatseisenbahnen, die Grossherzoglich Badischen Staatseisenbahnen sowie die Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen. Zweck dieser Zusammenarbeit war die Festlegung einheitlicher Regelungen für die Beförderung von Personen und Gütern, die Festsetzung eines gemeinschaftlichen Fahrplans, die Abrechnung über die Transporteinnahmen, die Sicherheit des Betriebs, die Gewährleistung freier Fahrt sowie die Bekanntmachung von Veränderungen im Fahrwasser. Neben dem einheitlichen Fahrplan erreichten die Vereinigten Dampfschifffahrts-Verwaltungen 1867 die Einführung der internationalen Schifffahrts- und Hafenordnung.
1884 schloss sich auch die k.u.k. Österreichische Bodenseedampfschifffahrt der Verbindung an, die sich gleichzeitig als Verband konstituierte. In den Konferenzen der Dampfschifffahrts-Inspektoren wurden die Anträge für die Verbandskonferenzen vorberaten.
Die NOB gehörte nicht nur den Vereinigten Bodensee-Schifffahrtsverwaltungen an, sie war ab 1897 auch Mitglied beim Verband Schweizerischer Dampfschifffahrtsunternehmungen, der für die Schweiz einen ähnlichen Zweck verfolgte.
|
| 1902 wurde die NOB verstaatlicht und in die SBB überführt. Damit wurde die NOB-Schifffahrt zur SBB-Abteilung "Schifffahrtsinspektion Romanshorn". Die Leitung des Dampfschiffbetriebs, die zwischen 1857 und 1878 einem Verwalter unterstellt gewesen war, wurde ab 1902 vom Bahnhofsvorstand Romanshorn besorgt. 1996 wurde der SBB-Schiffsbetrieb privatisiert und die Schweizerische Bodensee-Schifffahrtsgesellschaft AG gegründet.
Infrastruktur
Am schweizerischen Ufer des Bodensees gab es in Rorschach einen Hafen, der von den Dampfschiffen angelaufen wurde, im Kanton Thurgau interessierten sich verschiedene Seegemeinden für einen Hafen. Schliesslich erhielt Romanshorn vom Regierungsrat des Kantons Thurgau die Erlaubnis und baute 1842 einen eigenen Hafen.
Im Hinblick auf die 1855 eröffnete Eisenbahnlinie Winterthur - Romanshorn erweiterte die NOB von 1853 bis 1856 den Romanshorner Hafen und schuf damit die grösste Hafenanlage des Bodensees. 1872 (1861-1864 gemäss SBS) wurde eine Schiffswerft erstellt, die 1904-1906 umgebaut wurde. Nun hatte Romanshorn einen Werfthafen und eine moderne Hellinganlage, um die Schiffe von der Werft ins Wasser zu lassen oder herauszuholen.
Güterverkehr und Fährbetrieb
Ab 1847 führten mehrere Eisenbahnlinien bis zum Bodensee, während der Bodenseelängsverkehr (Bodensee-Gürtelbahn) mit der Eisenbahn noch nicht möglich war. Daraus entstand das Bedürfnis, die Endpunkte der verschiedenen Bahnlinien über den See miteinander zu verbinden, um Güter rasch über den See zu transportieren. Die Lösung fanden die Gesellschaften in den Trajektkähnen, die mit Eisenbahnwagen beladen werden konnten. Um den Güterverkehr zu regeln, schloss die NOB 1866 mit den Königlich Württembergischen Staatseisenbahnen und 1869 mit den Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen entsprechende Verträge ab.
Ab 1869 wurden in verschiedenen Häfen Trajektanstalten zum Beladen der Trajektkähne gebaut. Gemeinsam mit den Königlich Württembergischen Staatseisenbahnen liess die NOB im Jahr 1869 eine Trajektfähre (die sogenannte Dampftrajekt I) bauen und betrieb sie in der Folge auf der Strecke zwischen Romanshorn und Friedrichshafen. 1873 eröffnete die NOB zusammen mit den Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen eine weitere Fährverbindung zwischen Lindau und Romanshorn und betrieb sie mit dem Dampftrajekt II. Zwischen 1873 und 1884 florierten die Trajektverbindungen und es entstanden weitere Verbindungsstrecken.
1884 stellte die NOB zwei Trajektkähne in den Gemeinschaftsdienst: den Trajektkahn A oder M.Tr.2 (inoffizieller Name "Rorschach", 1963 ausser Dienst gestellt und 1966 abgebrochen) und den Trajektkahn B oder M.Tr.1 (inoffizieller Name "Romanshorn", abgebrochen 1946).
Ab 1929 wurden neben Eisenbahnwagen auch Autos und Personen befördert. Die deutsche MF Schussen übernahm diesen Dienst. Das erforderte bauliche Anpassungen im Romanshorner Fährhafen.
1934 übernahmen die SBB den anfänglich österreichischen Trajektkahn II, bauten ihn zu einem motorisierten Trajektkahn um und gaben ihm die Bezeichnung M.Tr.3 (abgebrochen 1974).
Während des Zweiten Weltkriegs wurde der grenzüberschreitende Trajektverkehr eingestellt, die Wiederaufnahme erfolgte 1948. 1976 wurde der Trajektverkehr auf dem Bodensee endgültig aufgegeben – aus betriebstechnischen Gründen und weil er zu kostenintensiv war.
|
| Bis 1982 wurde der Fährdienst zwischen Romanshorn und Friedrichshafen lediglich von den beiden Schweizer Fährschiffen MF Romanshorn (Inbetriebnahme 1959) und MF Rorschach (Inbetriebnahme 1966) bedient.Dann wurde zwischen der Deutschen Bahn und den Schweizerischen Bundesbahnen ein Gemeinschaftsvertrag für einen Autofährbetrieb unterzeichnet. Beide Gesellschaften stellten dazu ein Schiff zur Verfügung: Die SBB setzten die MF Romanshorn dafür ein und die MF Rorschach wurde 1983 den deutschen Bodensee-Schiffsbetrieben übergeben, die sie als MF Friedrichshafen weiter betrieben. 1996 folgte dann noch zusätzlich die MF Euregia, die beiden Gesellschaften gemeinsam gehörte.
Passagierschifffahrt
Der aufkommende Ausflugsverkehr brachte es mit sich, dass die Schifffahrtsgesellschaften einen neuen Betriebszweig entdeckten. Dazu brauchte es aber speziell ausgerüstete Schiffe, um bequemeres Reisen zu ermöglichen. 1855 liess die NOB die Salonschiffe SS Thurgau (abgebrochen 1911) und SS Zürich (abgebrochen 1919) bauen.
Ab 1877 wurden sogenannte Halbsalondampfer gebaut, das waren Schiffe mit halb in den Rumpf versenktem Salon und geringerem Tiefgang, die auch im Winterhalbjahr eingesetzt werden konnten, wenn der Wasserstand saisonalbedingt tief ist.
1887 setzte die NOB mit der SS Helvetia den ersten grossen Halbsalondampfer in Betrieb (versenkt 1932). 1892 folgten die SS Säntis (versenkt 1933) und 1897 die SS St. Gotthard (abgebrochen 1944).
Die SBB gaben nach der Übernahme der NOB den Bau von zwei neuen Schiffen in Auftrag: 1905 wurde die SS St. Gallen (abgebrochen 1960) und 1906 das Schwesternschiff SS Rhein (abgebrochen 1966) gebaut. Beide wurden 1931 zu Salondampfern umgebaut.
Technologien
Nicht nur den Bedürfnissen der Fahrgäste wurden die Schiffe angepasst, auch neue Technologien hatten immer wieder Umbauten zur Folge. 1925 wurden die ersten Dieselmotorschiffe eingesetzt, ab 1932 liessen die SBB die MS Thurgau und die MS Zürich umbauen. Dieselantrieb brauchte im Vergleich zum Dampfbetrieb weniger Personal und die Schiffe waren sofort betriebsbereit. 1958 bzw. 1959 erfuhren beide Schiffe eine Modernisierung und Anpassung an den ästhetischen Stil der damaligen Zeit.
Der Voith-Schneider-Antrieb ermöglichte ab 1931 eine bessere Manövrierfähigkeit. Die 1958 bzw. 1966 gebauten MF Romanshorn und MF Rorschach wurden mit einem Voith-Schneider-Antrieb ausgestattet.
Das Ende der Dampfschifffahrt wurde jedoch erst in den 1960er-Jahren eingeläutet: 1966 wurde die SS Rhein ausgemustert und damit ging die Zeit der Raddampfer auf dem Bodensee zu Ende.
|
| Bestandsgeschichte: | 1996 wurde der SBB-Schiffsbetrieb ausgelagert und die Schweizerische Bodensee-Schifffahrtsgesellschaft SBS gegründet, die diesen im Auftrag der SBB (als Tochter der SBB) weiterführte. Die SBS übernahm damit auch das Archiv der Schifffahrtsinspektion Romanshorn. 2007 wurde die SBS privatisiert.
Im November 2020 sichtete SBB Historic das Material und erklärte sich bereit, einen kleinen Teil des Archivs zu übernehmen, während der weitaus grössere Teil starken Schimmelbefall aufwies und wegen der aufwändigen Reinigungsarbeiten nicht erhalten bleiben sollte. Einen weiterern Teil des Archivs wollte das Museum am Hafen übernehmen. Das Staatsarchiv unterbreiteten nach einer Sichtung allen Beteiligten das Angebot, das gesamte Archiv zu übernehmen, es reinigen zu lassen und zu erschliessen. Mit diesem Vorschlag waren SBB Historic und das Museum am Hafen einverstanden. Daraufhin schenkte die Schweizerische Bodensee-Schiffahrtsgesellschaft das Archiv dem Staatsarchiv des Kantons Thurgau.
Im Dezember 2020 wurde das Material von der docusave AG übernommen und von Januar bis Juni 2021 dekontaminiert sowie gereinigt und konservatorisch bearbeitet. Über den Zustand der von der docusave übernommenen Dokumente wurde eine detaillierte Fotodokumentation erstellt (vgl. Bestandsdossier).
Der Bestand wurde von Susanne Grieder in der Zeit zwischen dem 1. September 2021 und dem 10. Februar 2022 mit einem Aufwand von 750 Stunden erschlossen.
|
|
Inhalt und innere Ordnung |
| Bewertung und Kassation: | Kassation von Dubletten.
|
| Ordnung und Klassifikation: | Sowohl aus der Zeit der NOB, wie auch für die Zeit ab 1903 wurden die Akten in Konvoluten zusammengefasst und mit Signaturen versehen. Ein SBB-internes Signatursystem wurde direkt auf den einzelnen Akten vermerkt.
Um ein einheitliches System für den ganzen Bestand zur Verfügung zu haben, entschloss sich das Staatsarchiv, eine neue Struktur beruhend auf Themenbereichen zu bilden. Dabei standen die internationalen Beziehungen zur Regelung der Bodensee-Schifffahrt an erster Stelle, da sie die rechtliche Grundlage für den schweizerischen Schifffahrtsbetrieb auf dem Bodensee bildeten, während die nationalen Verbände, denen die NOB und später die SBB angehörten, dieselbe Aufgabe innerhalb der Schweizerischen Schifffahrt erfüllten.
Die Schifffahrtsinspektion Romanshorn hatte im Wesentlichen drei Aufgaben, die bei der Gliederung des Bestands übernommen wurden: den Betrieb und die Aufrechterhaltung der Häfen und Werkstätten (Hauptfonds Gebäudeinfrastruktur), den Betrieb und die Aufrechterhaltung der Schiffe (Hauptfonds Schiffe) sowie den Betrieb der Schifffahrt (Hauptfonds Geschäftsbetrieb). |
|
Zugangs- und Benutzungsbedingungen: |
| Rechtsstatus: | Eigentum des Staatsarchivs des Kantons Thurgau.
|
| Zitiervorschlag: | Fussnote: StATG 8'428, */*
Quellenverzeichnis: StATG 8'428 Bodenseeschifffahrt der Schweizerischen Bundesbahnen 1850-1993
|
| Sprachen: | Deutsch.
|
|
Sachverwandte Unterlagen: |
| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | 4'150, 1 Beziehungen zur Eidgenossenschaft: Eisenbahnen, Schifffahrt und Statistiken
4'160, 0 Internationale Schifffahrt
4'160, 1 Fahrpläne und Konzessionen
4'161, 4 Schweizerische Bundesbahnen: Trajektverkehr
4'162, 1 Drucksachen: Ephemera, Monographien und Separatdrucke
4'235'0-3 Schifffahrt
Stadtarchiv Zürich:
VII.419. Escher Wyss AG. Firmenarchiv
Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg:
Y 21 Bodan-Werft
|
| Veröffentlichungen: | Bönke, Dietmar: Schaufelrad und Fllügelrad – Die Schifffahrt der Eisenbahn auf dem Bodensee, München 2013.
Fritz, Karl F.: Vom Raddampfer zur weissen Flotte. Geschichte der Bodenseeschifffahrt, Erfurt 2013.
Heer, Anton: Bodensee-Geschichte(n). Ein illustriertes Logbuch, Romanshorn 2016.
Heer, Anton: Seelinie und Trajekt: Visionen, Meilensteine, Episoden, Flawil 2019.
Krumholz, Emil: Die Geschichte des Dampfschiffahrtsbetriebes auf dem Bodensee. Innsbruck 1906.
Liechti, Erich; Gwerder, Josef; Meister, Jürg: Die Geschichte der Schiffahrt auf Bodensee, Untersee und Rhein, Schaffhausen 1981.
Meier, Jakob: Die Dampfschiffahrt auf dem Bodensee (in Thurgauer Jahrbuch, Jg. 30), Frauenfeld 1955.
N.N: Die schweizerische Dampfschiffahrt auf dem Bodensee – Chronik aus dem Jahr 1905, unveröffentlichtes Manuskript. (Vgl. 8'428, 9.3/2)
Scherff, Klaus: Die Bodensee Schiffsbetriebe, Heidelberg, Ubstadt-Weiher, Basel 2004.
|
|
Anmerkungen |
| Kommentar des Staatsarchivs: | Beim Wort Schifffahrt wird die Schreibweise mit drei f verwendet, auch wenn in den Akten diejenige mit zwei f verwendet wurde.
|
|
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/2013 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | uneingeschränkt |
| Accessibility: | Oeffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: |  https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=1304638 https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=1304638 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |
|