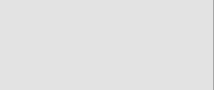
|
4'90-93 Forst 1803-1990, Fischerei 1803-1976, 1803-1990 (Abteilung)
Identifikation |
| Ref. code: | 4'90-93 |
| Title: | Forst 1803-1990, Fischerei 1803-1976 |
| Creation date(s): | 1803 - 1990 |
| Entstehungszeitraum, Streudaten: | approx. 1750 - 2010 |
| Level: | Abteilung |
Umfang |
| Running meters: | 59.50 |
| Number: | 1620 |
|
|
Kontext |
| Name der Provenienzstelle: | Forstregal 1804-1842, Forstverwaltung 1842-1906, Forst- und Fischereidepartement 1907-1936, Forstdepartement 1937-1990, Fischereiregal 1805-1906, Fischereidepartement 1937-1976. |
| Verwaltungsgeschichte/Biografische Angaben: | 2009 publizierte das Kantonsforstamt eine detaillierte historische Abhandlung des Thurgauer Forstdienstes von der Helvetik bis zum Jahr 2009, worauf sich die nachstehenden Bemerkungen zu den wichtigsten Etappen der Verwaltungsgeschichte beziehen (vergleiche: Der Forstdienst im Kanton Thurgau 2009, S. 6-86). Eine historische Aufarbeitung des Thurgauer Fischereiwesens blieb indes aus, die Hauptzäsuren werden im Folgenden benannt:
Forstregal 1804-1842; Fischereiregal 1805-1831/1890-1906
Über die thurgauischen Waldeigentumsverhältnisse der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vermittelt Johann Adam Pupikofer (1797-1882) einen eher negativen Eindruck: „Der grösste Theil der Waldung ist unter Privateigenthümer in Jucharte, Viertelsjucharte, oft sogar Achtelsjucharte zerstückt; die weitläuftigsten Gemeindewaldungen besitzen Frauenfeld, Diessenhofen, Güttingen, Tägerwylen, Mühlheim, Bischofzell, Steckborn. Die dem Staate zugehörige Waldung der Komthurei Tobel ist ebenfalls bedeutend. Allein alle diese Waldungen werden nicht nach einem übereinstimmenden oder auf rechtlichen Basen beruhenden Plane verwaltet. Der Privateigenthümer kann mit seinem Gehölze anfangen, was er will, und kein Gesetz verwehrt es ihm, seine Parzelle Wald mitten aus dem Waldbestande heraus zu hauen oder gar auszureuten. Bei neuen Holzschlägen wird auch gewöhnlich die frische Besaamung ganz der Natur überlassen, und diese dabei so schlecht unterstützt, dass sogar vernachlässigt wird, Samenbäume stehen zu lassen.“
Pupikofer kritisierte in erster Linie die unkontrollierte Rodung der Waldungen beziehungsweise die fehlende staatliche Intervention und sah einzig bei der aufkommenden Industrialisierung eine Entwicklungschance für den Thurgauer Wald als Einkommensquelle: „Da der Gesetzgebung im Privatrechte unübersteigliche Hindernisse die Einführung einer allgemeinen Forstordnung unmöglich machen, so wird die Verbesserung der Waldkultur einzig von dem Drange des sich vermehrenden Bedürfnisses zu erwarten seyn. […] Noch ist die Waldkultur so erträglich nicht wie der Getreidebau, und so dürfte es sich noch lange verziehen, bis die allgemeine Aufmerksamkeit auch diesem vernachlässigten Zweige der Wirthschaft und dem Sparsysteme in der Feuerung sich zuwendet.“ (Beide Zitate aus: Pupikofer 1837, S. 92-93). Der Thurgauer Wald war folglich in drei Waldbesitzgattungen unterteilt: Staatswald, Waldungen von Gemeinden und Bürgergemeinden sowie Privatwald (rund zwei Drittel der Waldfläche). Als vierte Gattung kamen die Korporationswaldungen hinzu.
Ein ähnliches Bild bot auch das Fischereiwesen: Pupikofer berichtet, dass im Obersee die Fischerei „ganz frei gegeben ist“, im Untersee dagegen die „alte, von dem Abt der Reichenau und den Gemeinden am Untersee aufgestellte Fischerordnung noch in Kraft“ sei. Durch sie wurde bestimmt, mit welchen „Fangwerkzeugen“ und Fischereipraktiken und zu welcher Jahreszeit der Fang betrieben werden durfte (Pupikofer 1837, S. 94). Anschliessend bezieht er sich auf die Fischenzen und auf das während der Mediation geschaffene Gesetz vom 21. Dezember 1808, indem er resümiert: „Die Fischerei in der Thur, Murg und kleinern Gewässern wurde eine Zeit lang von der Kantonsregierung als Regale in Anspruch genommen, aber da die Vollziehung mehr Schwierigkeit verursachte, als der Ertrag werth war, 1831 wieder freigegeben.“ (Pupikofer 1837, S. 95)
Nach 1831 liess sich ein stiefmütterlicher Umgang mit den Fischereiangelegenheiten beobachten. Bis 1857 scheint das Fischereiwesen noch dem Regierungsrat unterstellt gewesen zu sein. Mit der Genehmigung des Grossen Rats erklärte der Regierungsrat mittels der Verordnung vom 9. Juli 1877 das Fischen in Thur, Sitter und Murg sowie die Patentfischerei im Ober- und Untersee zur Kantonssache. Die Vergabe der Fischenzen in den kleineren Flüssen und öffentlichen Bächen überliess der Kanton den Gemeinden.
|
| Die Bestimmung von 1877 blieb jedoch bis zur neuerlichen Verordnung vom 28. Februar 1890 scheinbar ohne greifbare Auswirkungen. Erst 1890 wurde im Rahmen zum Vollzug des Bundesgesetzes vom 21. Dezember 1888, der bundesrätlichen Verordnung und der Spezialverordnung zum Art. 21 des Bundesgesetzes betreffend „Verunreinigung der Gewässer zum Nachteil der Fischerei“ (beide vom 3. Januar 1889) die Stellen zweier Fischereiaufseher geschaffen (kantonaler Beschluss vom 26. Februar 1890). Jeder Inspektor war für einen Bezirk verantwortlich (I: Untersee und Rhein und Oberseegebiet des Bezirkes Kreuzlingen, II: Oberseegebiet des Bezirkes Arbon) und schuldete direkt dem Vorsteher des Departements für die inneren und volkswirtschaftlichen Angelegenheiten Rechenschaft (Rechenschaftsbericht 1890, S. 50). Bis 1906 erledigten zwei Beamte die anfallende Arbeit. Ab 1907 waren jeweils drei bis vier Männer für insgesamt vier Fischereikreise zuständig.
Forst- wie Fischereiregal standen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts somit unter ausgesprochen liberalen Vorzeichen. Vor der Gründung einer (Staats-)Forstverwaltung im Kanton Thurgau führte Johann Conrad Freyenmuth (1775-1843) als Regierungsrat (1804-1833) und Staatskassier (1833-43) die Forstbelange nebenamtlich. Nach seiner Wahl in den Kleinen Rat erhielt er 1804 das Finanzdepartement, das das Forst-, Salz-, Zoll- und Postwesen, Verwaltung der Domänen, etc. umfasste. Die ersten Staatswälder erwarb der Thurgau 1804 im Rahmen des Meersburger Vertrags, der die Übergabe der auf Schweizergebiet befindlichen Besitztümer des vom Lande Baden säkularisierten Fürstbistums Konstanz an den Kanton Thurgau regelte (Neuwiler Wald, Güttingen, Bischofszell-Schönenberg, etc.). Um die Staatskassen zu füllen, veräusserte der Kanton zwischen 1806 und 1809 einen Grossteil dieser Waldungen an Gemeinden und Korporationen. 1807 gelangte mit der Aufhebung des Johanniterordens die Komturei Tobel mit ihren 128 ha Wald in Staatsbesitz und bildete zusammen mit dem 1827 zugekauften ehemaligen Hof Bietenhard den Grundstock des künftigen Thurgauer Staatswalds. Drei Jahre später wurde auf dem Gebiet in Bietenhard ein Pflanzstock aufgeforstet und aktiv bewirtschaftet. Die Thurgauer Staatswaldungen wurden in der Folge auf zehn Gebiete erweitert: Bichelsee, Bietenhard, Feldbach, Fischingen, Ittingen, Kalchrain, Kreuzlingen, St. Katharinental, Tänikon und Tobel.
Forstverwaltung 1842-1906
Nachdem die Klostergüter mit Beschluss vom 14. Juni 1836 schon zwölf Jahre vor deren Aufhebung am 27. Juni 1848 unter die Oberaufsicht des Staates gestellt worden waren, wurden gesetzliche Rahmenbedingungen und verwaltungsorganisatorische Anpassungen notwendig. Übrigens wurde das Kloster Paradies bereits 1836 aufgehoben, ein vorläufiger Aufschub wurde für Katharinental bewilligt, da sonst der Waldbesitz aufgrund des Epavenrechts ohne Entschädigung an das Grossherzogtum Baden gefallen wäre (Epavenrecht = fiskalisches Okkupationsrecht bei inländischen Besitzungen, Renten und Rechten auswärtiger säkularisierter geistlicher Stiftungen, in: Kaiser, Simon: Die Wissenschaft des schweizerischen Rechtes, Buch III, St. Gallen 1860, S. 280). 1869 wurde der genannte Vertrag aufgehoben und auch dieses letzte thurgauische Kloster säkularisiert.
Am 12. Juni 1839 übergab der Regierungsrat dem Grossen Rat einen Entwurf für eine Forstordnung und ein Forstgesetz, wobei das gesamte Forstwesen im Kanton unter die Aufsicht des Kleinen Rats zu stellen und zur Ausführung ein Fostinspektor beamtet worden wäre. Der Entwurf missfiel jedoch insbesondere den waldbesitzenden Gemeinden, die diese staatliche Intervention klar ablehnten; ebenso wurden die folgenden Forstgesetzentwürfe aus den Jahren 1860 und 1871 nicht angenommen. Der Gesetzesentwurf wurde vor diesem Hintergrund am 1. Oktober 1839 vom Grossen Rat verworfen. |
| Möglicherweise war dieser Entscheid auch der Tatsache geschuldet, dass die kantonalen Verwalter der Klosterwaldungen einen schlechteren Umsatz erzielten, als die bisherigen Klosterverwalter.
Aus dem Rechenschaftsbericht des Regierungsrats geht hervor, dass 1841 konkret über die Schaffung einer Forstorganisation diskutiert wurde: „Die Bemerkung Ihrer Kommission [Grosser Rat], über die Einführung einer geregelten Behandlung und Benutzung der Staats- und Klosterwaldungen werden uns zu unverzüglichen Berathungen der Sache veranlassen.“ (S. 26) Die grossrätliche Diskussion führte zur provisorischen Schaffung einer Forstinspektorstelle auf zwei Jahre (Rechenschaftsbericht 1842, S. 23). Als erster hauptamtlicher Forstinspektor wurde der vormalige Verwalter des Schlossgutes Altenklingen, Johannes Stähelin (1800-1866), gewählt. Seine erste Aufgabe bestand darin, ein Inventar der Staats- und Klosterwaldungen zu verfassen. Im Rechenschaftsbericht des Regierungsrats aus dem Jahr 1843 wurde er dahingehend paraphrasiert, „dass sowohl die Staats- als auch Kloster-Waldungen im Allgemeinen in einem gesunkenen, hie und da sogar verwahrlosten Zustande sich befinden.“ In demselben wurden auch die Hauptaufgaben der neugeschaffenen Forstverwaltung skizziert, indem sowohl die „hemmenden“ Servitute als auch die „schwer drückenden“ Lehensverhältnisse der Klosterwälder ins Zentrum gerückt wurden (beide Zitate S. 21).
Im folgenden Jahr wurde beschlossen, „[d]as Provisorium des Forstinspektorats […] in forstlichem Interesse auf unbestimmte Zeit verlängern zu sollen.“ (Rechenschaftsbericht 1844, S. 23-24) Dass sich die Hauptaufgaben der neuen Forstverwaltung nicht nur auf die Inventarisation, sondern massgeblich auf die Bewirtschaftung und Kultivierung der Waldflächen erstrecken sollten, wurde 1844 folgendermassen umrissen: „Nebst allgemeinen Einleitungen, als Abstellung der gröbsten Missbräuche in der Betriebsweise, Controlirung der Waldhüter, Inspektion der Waldungen, Vermessung und Gränzregulirung, soll nun aber in der Folge ein spezielleres Einschreiten in dem Wirtschaftsbetrieb dieser Waldungen eintreten, und wir werden, sowohl um die zeitraubenden Betriebs-Regulirungen als namentlich auch die Waldkulturen in lebendigen raschen Gang zu bringen, in den Fall kommen, dem Inspektor einen Forstgehülfen [in Person des Johann Jakob Kopp (1819-1889) aus Steckborn] beizugeben.“ (S. 26)
Auf dieser Grundlage beschloss der Regierungsrat am 25. April 1846 die Gründung einer kantonalen Forstverwaltung unter der Oberaufsicht des Finanzdepartements. Die Waldinspektionen und übrigen Belange der Bürgergemeindewaldungen wurden unter die Supervision des Departements des Innern gestellt. Der neugeschaffenen kantonalen Forstverwaltung stand zuerst ein Präsident vor: Von 1846-1848 war dies Oberstdivisionär Johann Konrad Egloff (1808-1886) und anschliessend 1848-1864 Gerichtspräsident Daniel Kesselring (1805-1878). Dem Präsidenten waren die Bezirks-Forstmeister Stähelin und Kopp über ihre beiden Forstbezirke Rechenschaft schuldig. Die Forstverwaltung tagte als Dreiergremium im Abstand von rund zwei Wochen und besprach die anfallenden Amtsgeschäfte. Betreffe über die Kloster- und Staatswälder wurden zu Anträgen an das Finanzdepartement, diejenigen über das Gemeindeforstwesen zu Anträgen an das Departement des Innern formuliert. Dieses Präsidium wurde bis 1871 beibehalten, anschliessend unterstand die Forstverwaltung direkt dem Finanzdepartement.
|
| Nach dem Tod Forstmeister Stähelins am 26. Februar 1866 leiteten der vormalige Adjunkt Anton Schwyter (1840-1927) und dessen Sohn bis 1944 die Thurgauer Forstverwaltung. 1866 trat zudem Gerichtspräsident Kesselring vom Präsidium zurück, und der Regierungsrat beschloss eine vereinfachte Forstorganisation: Der Vorsteher des Finanzdepartements übernahm die direkte Aufsicht über das Staatsforstwesen, der Kantonsforstmeister übernahm das Aktuariat der Forstverwaltung und inspizierte die Gemeindewaldungen gemäss den ab den 1860er Jahren eingeführten Reglementen der Bürgergemeindewaldungen. Neben Schwyter als Forstverwaltungsvorsteher und Inspektor des I. Forstbezirks, führte Kopp den II. Forstbezirk. Nach der Verwerfung des Forstgesetzes im Jahr 1871 kündigte Kopp, der gleichzeitig auch Professor an der Eidgenössischen Technischen Hochschule, Zürich, war, seine Stelle, und das gesamte Forstwesen wurde Schwyter überlassen. Erst am 14. Januar 1899 bewilligte der Regierungsrat erneut eine Adjunktenstelle. Neben den Forstingenieuren („höherer Forstdienst“), die die Führung der Forstverwaltung übernahmen, standen für die Beförsterung des Staats- und Klosterwalds beispielsweise im Jahr 1852 21 Revierförster im Einsatz („unterer Forstdienst“).
Die Bewirtschaftung von Bürgergemeindewaldungen wurde in den 1860er Jahren durch die kantonale Verordnung für die Durchsetzung einer geordneten Forstkultur vom 28. April 1861 und die Einführung von Waldreglementen vereinheitlicht und professionalisiert. Die Gemeinderevierförster pflegten die Bürgerwaldungen und übernahmen einerseits hoheitliche Staatsaufgaben, andererseits arbeiteten sie aber im Angestelltenverhältnis der verwaltungsexternen Waldeigentümer (Korporationen und Gemeinden). Die Förderung des „Unteren Forstdienstes“ für Förster, Bannwarte und Waldhüter sah ab 1849 auch Försterkurse vor, bei denen der Kanton die Gemeinde- und Staatsförster im Turnus von drei bis fünf Jahren weiterbildete.
Die Forstbelange waren ursprünglich eine reine Kantonsangelegenheit, erst mit dem 1876 eingeführten Bundesgesetz betreffend „die eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei im Hochgebirge“ (Forstpolizeigesetz) erstreckten sich die Bundeskompetenzen auch in die Kantonswälder. Der Thurgau war von diesem Gesetz aufgrund seiner geographischen Lage vorerst nicht betroffen und musste somit keinen gesetzlich geforderten Schutzwald ausweisen. Erst mit einer Volksabstimmung über den Artikel 24 in der Bundesverfassung im Jahr 1897 und der damit verbundenen Ausweitung des Bestimmungsrayons auch auf den Thurgau wurden Vorkehrungen zur Verhinderung schädlicher Abholzungen getroffen. Um dies umzusetzen, wurden im Privat- und Gemeindewald ab sofort alle Kahlschläge und Abholzungen zum Zwecke des Holzverkaufs unter die Bewilligungspflicht der Kantonalbehörde gestellt (Schlag- und Rodungsbewilligungen). |
| Forst- und Fischereidepartement 1907-1936
Die nächste organisatorische Zäsur liess sich auf das Bundesgesetz betreffend die eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei vom 11. Oktober 1902 zurückführen. Das Gesetz forderte die Kantone zur Erstellung von Vollziehungsverordnungen und zur Ausscheidung von Schutzwaldgebieten – im Thurgau im Einzugsgebiet der Murg in der Munizipalgemeinde Fischingen – auf, wofür sich der Kanton Thurgau bis im Jahr 1907 Zeit liess (Regierungsratsbeschluss vom 16. Februar 1907).
Die kantonale Vollziehungsverordnung zum genannten Bundesgesetz brachte auch die Reorganisation der Forstverwaltung (Gemeindewald unterstand nicht mehr dem Departement für Inneres und Volkswirtschaft, sondern wurde dem Forst- und Fischereidepartement zugeschlagen) und neu die Integration des Ressorts Fischerei mit sich. Es wurden drei Forstkreise geschaffen und der erste Schutzwaldförster für die Munizipalgemeinde Fischingen gewählt sowie vier Fischereikreise ausgewiesen. Die Wege des Forst- und Fischereiwesens trennten sich organisatorisch 1936/1937 wieder, wobei sie noch bis 1943 demselben „Departementekonglomerat“ angehörten: Finanz-, Fischerei-, Forst- und Vormundschaftsdepartement.
Forstdepartement 1937-1990; Fischereidepartement 1937-1976
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 1946 eine neue Forstordnung geschaffen. Sie brachte einen vierten Forstkreis, die Neubildung der Beförsterungskreise sowie die Bestimmungen über Waldzusammenlegungen im Bereich des Privatwalds mit sich. Hier wirkte insbesondere Regierungsrat Willy Stähelin (im Amt 1936-1968) massgeblich mit. Mit der Schaffung eines fünften Forstkreises im Jahr 1959 wurde die 1946 getroffene Forstordnung amendiert und 1963 unter das Schutzwaldstatut gestellt. Damit wurden die rechtlichen Voraussetzungen für die finanzielle Unterstützung von Forstverbesserungen wie Wegebau, Aufforstungen und Verbauungen geschaffen.
Das Fischereidepartement blieb bis am 5. Dezember 1976 eigenständig beziehungsweise im Verbund des „Strassen- und Bau-, Assekuranz-, Fischerei- und Vormundschaftsdepartements“ und wurde anschliessend mit dem Jagdwesen in der Jagd- und Fischereiverwaltung innerhalb des „Justiz-, Polizei- und Fürsorgedepartements“ verankert. |
|
Organisatorische Übersicht des Thurgauer Forst- und Fischereiwesens im 19./20. Jh.:
Forstwesen: 1804-1842 Forstregal (Finanzkommission/Finanzdepartement), 1842-1906 Forstverwaltung (Staatswald in der Zuständigkeit des Finanzdepartements und der Gemeindewald ab 1859 in der Zuständigkeit des Departements für Inneres), 1907-1921 Forstdepartement (Forst- und Fischereidepartement), 1922-1936 Forst- und Fischereidepartement (Finanz-, Forst- und Fischereidepartement), 1937-1943 Forstdepartement (Finanz-, Fischerei-, Forst- und Vormundschaftsdepartement), 1944-1990 Forstdepartement (Finanz-, Forst- und Militärdepartement).
Fischereiwesen: 1805-1831 Fischereiregal (Regierungskommission für Äusseres/Diplomatische Kommission), 1832-1857 Fischereiregal (Unterstellung vermutlich Gesamtregierungsrat, anschliessend unklar), 1890-1906 Fischereiangelegenheiten (Departement für die inneren und volkswirtschaftlichen Angelegenheiten), 1907-1936 Forst- und Fischereidepartement (Forst- und Fischereidepartement), 1937-1943 Fischereidepartement (Finanz-, Fischerei-, Forst- und Vormundschaftsdepartement), 1944-1976 Fischereidepartement (Strassen- und Bau-, Assekuranz-, Fischerei- und Vormundschaftsdepartement). |
| Bestandsgeschichte: | Die Dienststellen mit ihren Amtsarchiven waren zuerst im Regierunggebäude, anschliessend an der Thundorferstrasse und schliesslich an der Spannerstrasse in Frauenfeld untergebracht, wobei die Kreisforstmeister und die Fischereiaufseher ausserhalb Frauenfelds ihre Büroräumlichkeiten (teilweise in Privathaushaltungen) hatten.
Registratur im Amt
Über die Aktenablage in der Forstverwaltung sowie der Fischereiangelegenheiten kann nur spekuliert werden. Diejenige der Forstverwaltung scheint sehr konzis und in Dossierstruktur geführt worden zu sein; hiefür sprechen die Handhabung von Aktenzeichen sowie Register für einzelne Aktenreihen (Schlagbewilligungen, Rodungsbewilligungen, etc.). Die Protokolle der Forstverwaltung zwischen 1842 und 1870 wurden beispielsweise als Beschlussprotokolle geführt und korrespondierten über die fortlaufende Beschlussnummer (§§) mit den zugehörigen Geschäftsakten. Die ebenfalls im Bestand befindlichen „Allgemeinen Akten“ des Finanzdepartements und Departements des Innern bildeten Geschäftsdossiers (inklusive Korrespondenzen, Berichten und dem daraus resultierenden Regierungsratsbeschluss), die chronologisch nach Regierungsratsbeschluss-Nummern abgelegt wurden. Ursprünglich als Loseblattablage gedacht, wurden sämtliche zusammengehörenden Dokumente mit einem Aktenzeichen versehen. Die Allgemeinen Akten des Forst- und Fischereidepartements zwischen 1907 und 1936 erhielten in den Manualen neben der fortlaufenden Geschäftsnummer auch eine Beschlagwortung (Fischereiwesen, Forstwesen, Forstdepartement, Regierungsratsbeschluss-Nummer, etc.). Korrespondenzbände waren nummeriert und indexiert.
Auch bei den Fischereiakten liessen sich verschiedene konzis geführte Aktenreihen feststellen: Die Allgemeinen Akten des Departements für die inneren und volkswirtschaftlichen Angelegenheiten wurden ebenfalls nach Regierungsratsbeschluss-Nummern geführt. Die Unterlagen bis 1906 hatten vornehmlich Korrespondenzcharakter und waren ausschliesslich an die zuständigen Regierungsräte gerichtet. Mit der Schaffung der Fischereiaufseher im Jahr 1890 traten auch deren Berichte und Schriftverkehr in Erscheinung, wohl als eingehende Korrespondenz des Regierungsrats. Weitere Aktentypen und Aktenreihen der Fischereiaufseher fehlten im Bestand. Dies war möglicherweise dem Umstand geschuldet, dass die zuerst nebenamtlichen und anschliessend vollamtlichen Angestellten keine Verwaltungsbüroräumlichkeiten besassen. Die Aktenführung des ab 1937 selbständigen Fischereidepartements wurde analog dem Schema „Manuale und Allgemeine Akten“ gehandhabt. Die ursprünglich klar nach Fällen abgelegte Ordnung wurde anschliessend (1959?) jedoch einer thematischen Gruppierung geopfert, so dass teilweise mehrere Fälle in ein Sammeldossier gelangten.
Zusammenfassend lässt sich über beide Themenbereiche Forst und Fischerei sagen, dass die ursprüngliche Registratur konzis und sauber geführt wurde, es sich in weiten Teilen offenbar um adaptierte Ablageschemen der Departementskanzleien handelte. Die Altregistraturen der Forstverwaltung wie auch der Fischereiangelegenheiten wurden in einem Estrich aufbewahrt, dafür sprachen das spröde und stark verschmutzte Papier und die sporadisch auftretenden Schädlingsspuren.
|
| Übergabe an das Staatsarchiv
Die Allgemeinen Akten des Departements für innere und volkswirtschaftliche Angelegenheiten (Gemeindewald) trugen neben dem Regierungsratsbeschluss-Aktenzeichen auch die Klassifikation „409 XV Forstwesen der Gemeinden“. Diese Kombination von arabischen und römischen Ziffern stammt aus einer Erschliessung unter dem Staatsarchivar Johannes Meyer (1835-1911) und entspricht der Signaturvergabe im „Repetorium der Verwaltungsbücher (Kopialbücher, Gefällbücher, Gerichtsbücher etc.) aus den Archiven der vormals thurgauischen Herrschaften“ aus dem Jahr 1899. Die Unterlagen der Forstverwaltung (weitere Departementalakten sowie Amtsakten) und der Fischereiangelegenheiten gelangten in nachstehenden Ablieferungen zwischen 1940 und 2011 ins Staatsarchiv Thurgau:
06.12.1940: Kanzlei Finanzdepartement: Manuale 1907-1935, Akten der Jahre 1918-1935; 21.05.1942: Kanzlei Finanzdepartement: Korrespondenzen Forst- und Fischereidepartement 1923-1935 ; 04.1988: Kantonsforstamt: Forstakten 1951-1960; 01.09.1988: Kantonsforstamt: Forstakten 1951-1960 (Wirtschaftspläne); 14.03.1989: Kantonsforstamt: Forstakten 1960-1969 (Wirtschaftspläne); A-1998-87: via Staatsarchiv Luzern (StALU): Eine Mappe Strassenbau, Holzverkauf, Holznutzung, verschiedenes Forstwesen TG 1934-1936; 2001-024: Kantonsforstamt: Projekte 1926-1989, Kontoblätter 1970-1987, Arbeitsrapporte und Waldarbeiterlöhne 1970-1984, Unfälle, etc., 1926-1989 (Hauptablieferung mit 12 Lfm); 2001-051: Kantonsforstamt: Wirtschaftspläne 1953-1988, Schlagbewilligungen 1967-1990, Forstliche Ausbildung 1964-1979, Eidg. Forststatistik 1967-1989; 2002-059: Generalsekretariat des Departements für Bau und Umwelt: „Allg. Akten Forstamt“ (Verfügungen, Waldfeststellungen, etc.) 1965-1990; 2003-020 Jagd- und Fischereiverwaltung: Fischereiakten, 1914-1995; 2003-022 Kantonsforstamt: Gemeindewaldungen und Übersichtspläne, Botanische Sammlung und Sammlung Insektenfrass, 1860-1950; 2011-004 Kantonsforstamt: Gesamtablieferung nach Registraturplan 2000 für die Jahre 1960 ca.-2000 (43 Lfm).
Die Ablieferungen 2003-020, 2003-022 und 2011-004 wurden im Staatsarchiv im Zwischenarchiv aufbewahrt, die übrigen im Endarchiv dem Bestand 4’90-4’93 zugeordnet (in Ordnern, nicht alterungsbeständigen Schachteln und lose).
|
| Erschliessung im Staatsarchiv 1983-1985
Die Erstbearbeitung im Staatsarchiv zwischen 1983 und 1985 richtete sich auf die Benutzung mit einem Zettelkatalog bzw. gedruckten Findmittel aus. Dem Bestand wurden vier Signaturreihen zugestanden (4’90 Departement allgemein, 4’91 Kantonsforstamt allgemein, 4’92 Kantonsforstamt Finanzielles und 4’93 Fischerei). Das damalige Ordnungsschema orientierte sich in erster Linie an der physischen Beschaffenheit der Akten (gebundene versus ungebundene) und anschliessend an Pertinenzen. Bei der Bearbeitung erlitt der Bestand teilweise irreversible Schäden: Bände wurden aufgeschnitten, um sie in Schachteln in einer „neuen Dossierstruktur“ abzulegen, korrespondierende Aktenreihen wurden einer pertinenten Zuweisung wegen geopfert (beispielsweise wurden die korrespondierenden Beschlussakten zu den Protokollen der Forstverwaltung 1843-1870 thematisch „verteilt“). Aufgrund der Grösse des Bestands, und womöglich im mangelhaften Überblick begründet, wurden auch fortlaufende Aktenreihen an verschiedenen Systematikpositionen abgelegt (beispielsweise wurden die gebundenen Schlagbewilligungen teilweise in Schachteln, teilweise freistehend archiviert und verzeichnet).
Resultat der Erstbearbeitung im Staatsarchiv war das Findmittelbuch vom November 1984 „Thurgauer Forstakten 1803-1950“ von Paul Pfaffhauser und Staatsarchivarin Verena Jacobi. Das Findmittel stellte die sogenannten Forstdepartementakten an die Spitze, anschliessend war es nach Archivalienart (nicht gebundene Forstakten und gebundene Forstakten) und schliesslich thematisch aufgebaut. Über das numerische Signaturensystem wurde eine alphabetische Klassifikation (der St. Galler Forstverwaltung) gelegt, wahrscheinlich um eine Pseudo-Fondsstufe einzurichten. Die nicht gebundenen Akten wurden bis auf Stufe Dossier erschlossen und stellten mehrheitlich Jahres- oder Mehrjahresdossiers dar. Hauptmerkmale des Findmittels waren somit eine Trennung nach Archivalienart und ein ausgesprochen thematischer Aufbau.
Spätere Ablieferungen des Kantonsforstamts wurden in den ursprünglichen Bestand eingearbeitet und in diversen handschriftlichen Notizen ergänzt (sogenannte „Fortsetzungen“). Dies widerspricht freilich dem Prinzip der Akzessionsarchive. Eine Neuauflage des handschriftlich ergänzten Findmittels unterblieb, somit stellte das gedruckte Findhilfsmittel keine vollständige Übersicht über den gesamten Bestand dar. Die Ergänzung des originären Bestands mit neuen Ablieferungen hatte natürlich auch Auswirkungen auf die physische Beschaffenheit und Magazinierung des Bestands. So mussten zwangsläufig Schachteln neu befüllt werden und die alten Schachtelsignaturen wurden hinfällig beziehungsweise korrespondierten nicht mehr mit dem Findmittel. Aufgrund der mannigfaltigen Eingriffe in die Bestandsstruktur und die Bemühung, dieselbe dennoch irgendwie transparent zu gestalten, waren die einzelnen Bearbeitungsschritte nicht mehr detailliert nachvollziehbar. Grundsätzlich kann von einer Bearbeitung vor 1984 (Akten aus dem Überlieferungszeitraum 1804-1951) und nach 1984 gesprochen werden (spätere Ablieferungen bis circa 1993). Um 1993 wurde das Findmittel abermals ergänzt und ein alphabetisches Register erstellt, dasselbe jedoch nie publiziert, und es schien zudem weder umfassend noch mit den Archivsignaturen kongruent zu sein. Das Ressort Fischerei sowie ein Grossteil der gebundenen Akten der Forstbelange wurden bei diesen Aktualisierungen ausser Acht gelassen und spiegelten somit den Status der Primärerschliessung mehr oder weniger wieder.
|
| Neben dem gedruckten Findmittel wurde ein Zettelkatalog (ca. 1987) erarbeitet. Dieser stimmte mit dem gedruckten Findmittel nicht überein. Erschlossen wurde im Katalog bis auf Stufe Archiveinheit (Schachtel oder Band). Der Katalog gab die ersten vier Hauptsignaturenreihen „Departement“, „Kantonsforstamt Allgemeines“, „Kantonsforstamt Finanzielles“ und „Fischerei“ wieder. Die Trennung zwischen gebundenen und nicht gebundenen Akten war hier kein Kriterium, eine Orientierung am Provenienzsystem war spürbar. Nach den Hauptfonds folgten die verschiedenen Aktenreihen Manuale, Kopierbücher, Allgemeine Akten, Jahresberichte, „Allgemeines, Personelles, Gesetzgebung“, Forstdirektorenkonferenz, etc.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass weder das gedruckte Findmittel noch der Zettelkatalog einen eindeutigen und zielgerichteten Zugriff auf die Akten erlaubten. Die damaligen Erschliessungsetappen umfassten nie den gesamten Bestand und wurden nicht einheitlich gehandhabt. Die Erschliessung suggerierte dem Benutzer eine Departementalstruktur mit untergeordnetem Amt und liess im Dunkeln, dass es sich bei den Ressorts Forst und Fischerei um anfänglich nebenamtlich geführte Aufgaben der Departemente sowie deren Vorsteher und erst allmählich um professionalisierte, institutionalisierte Dienststellen handelte. Nur zwischen 1907 und 1936 wurden die beiden Ressorts organisatorisch zusammengefasst und als eigenständiges Departement geführt.
Neubearbeitung 2012/13
Die Neubearbeitung des Bestands 4’90-4’93 sollte unter der Prämisse von vier Hauptsignaturreihen, der Orientierung am Provenienzprinzip und dem Grundsatz der Erschliessung auf Dossierstufe geschehen und somit die phasenweise Entwicklung der Ressorts Forst und Fischerei aufzeigen. Die Neubearbeitung setzte sich zum Ziel, dass der Bestand in erster Linie benutzbar gemacht, der Entstehungszusammenhang und die Authentizität der Akten wo möglich – und vom Aufwand her vertretbar – wieder hergestellt und für die dauerhafte Archivierung bereitgestellt würde (konservatorische Massnahmen). Die Dossierbildung orientierte sich in erster Linie an der Registratur des abliefernden Amts (Aktenzeichen, Geschäftsdossiers) und erst in zweiter Linie an der Ersterschliessung im Staatsarchiv. Dossiers, die bei der Primärerschliessung durch Einzelblattzuweisung gebildet wurden, konnten in der Regel nicht mehr rückgeordnet werden. Die Altsignatur(en) wurden bei der Neuverzeichnung nicht übernommen. Teilweise wurde mit Aktenzeichen gearbeitet, so dass die Überprüfung auf Vollständigkeit bei einer Mehrzahl der aufgezählten Aktenreihen prinzipiell möglich war. Lose Akten, die nicht mit Aktenzeichen versehen waren und deren Dossierbildung aufgrund der Erstbearbeitung des Bestands nicht mehr in allen Zügen nachvollziehbar waren, konnten nicht auf Vollständigkeit überprüft werden. Die seriellen Departementalakten sind bis auf wenige Dossiers vollständig überliefert worden. Keine Lücken bestehen bei den gebundenen Akten im Bereich der Jahresrechnungen des Staatswalds sowie wenige (eruierbare) Lücken im Bereich der Waldwirtschaftspläne.
|
| Der Zustand der Akten liess in Teilbereichen sehr zu wünschen übrig. Neben kleineren Wasserschäden und Tierfrassspuren waren besonders die Dokumente aus dem 19. und ersten Viertel des 20. Jahrhunderts mittelmässig bis stark verschmutzt, mussten gereinigt werden und tragen dementsprechend leichte Verfärbungen. Bände mussten von Staub und Löschsand gründlich befreit werden. Zerrissene oder fragementierte Dokumente treten gehäuft auf. Konservatorisch problematisch sind rund ein Zehntel der Bände der Serie „Waldwirtschaftspläne“, die in Plastik eingeschlagen waren. Ringheftungen bei 0,25 Laufmeter Waldwirtschaftsplänen wurden bei der Neubearbeitung durch alterungsbeständige Bindungen ersetzt. Darüber hinaus befinden sich im genannten Aktentyp Fotografien ab den 1910er Jahren, die bereits zum Zeitpunkt der Neuerschliessung (2012-2014) stark verblichen waren. Schadensbilder, die aufgrund der Erstbearbeitung im Staatsarchiv auftraten, waren unter anderem die Signaturvergabe mit Kugelschreiber auf die Originaldokumente des 19. Jahrhunderts – was auf eine Einzelblattzuweisung und somit intuitive/künstliche Dossierbildung schliessen liess –, die Auftrennung von gebundenen Akten und deren anschliessende kontextfreie thematische und chronologische Zuweisung (mit Informationsverlusten im Schnittbereich und Mittelfalz) und eine partielle Anpassung der Dokumente an die Schachtelgrösse.
Der Bestand wurde zwischen Juni 2012 und Juni 2014 von Ernst Guggisberg in rund 1850 Arbeitsstunden geordnet und erschlossen (insgesamt 8887 Datensätze); über die Details der Erschliessung geben die verschiedenen Versionen des Erschliessungskonzepts sowie die Informationen in den nachstehenden Feldern dieses Formulars Auskunft. |
| Direktübernahme von Provenienzstelle: | Ja. |
|
Inhalt und innere Ordnung |
| Bewertung und Kassation: | Umplatzierungen: Ein Sammeldossier mit Allgemeinen Akten der Finanzverwaltung aus dem Zeitraum 03.1907 bis 09.1907 wurde umplatziert sowie zwei Protokolle der „Waldkorporation Uttwil-Romanshorn“. Aus der Gesamtablieferung des Kantonsforstamts ZA 2011-004 wurden die Akten vor 1990 in den Bestand integriert.
Auswahl und Kassationen: Bei den Arbeitsrapporten 1949/1950-1974/1975, 1986/1987 wurden pro Staatsforstrevier jährlich die Zahlungslisten für Stunden- und Akkordlöhne nach Arbeitern sowie die Arbeitsrapporte gebunden. In ihrem Aufbau erfuhren sie über die gesamte Zeitspanne keine Veränderung. Zur Diskussion wurde die Auswahl jeden zehnten Jahrganges gestellt (1949, 1959, 1969, 1979) und zum Beschluss erhoben, was eine Reduktion der vier auf 0.4 Laufmeter mit sich brachte. Die Gesuche um Bewilligung von Holzschlägen in den Privatwaldungen (Schlagbewilligungen) aus den Jahren 1937 bis 1990 waren in den Registraturplänen des Kantonsforstamts 2002 und 2006 als kassationswürdig eingestuft (im Gegensatz zu den Rodungsgesuchen). Im Bestand waren die sieben Register über die Schlagbewilligungen 1937-1971 sowie die für diese Zeit korrespondierenden 24 Schachteln (zwei Laufmeter) Gesuchsdossier vollständig überliefert worden (beinhaltend: Korrespondenz Gesuchsteller und Kantonsforstamt, Antrag des Kreisforstmeisters an das Forstdepartement). Beschlossen wurde die integrale Aufbewahrung der sieben Registerbände sowie die Auswahl und Kassation der Schlaggesuche (integrale Aufbewahrung 1937-1949, 1959, 1969, 1979 und 1989), was eine Reduktion von zwei auf ca. 0,5 Laufmeter mit sich brachte. Für die Aufbewahrung der Kriegsjahre und Nachkriegsjahre 1937-1949 sprachen die gehäuften Rodungsgesuche im Rahmen der Anbauschlacht (integral bewertet), die mit den Schlagbewilligungen in Bezug gesetzt werden können. |
| Ordnung und Klassifikation: | Bei der Erstbearbeitung in den 1980er Jahren wurde der Bestand im Findmittelbuch teilweise bis auf Stufe Dossier erschlossen, im Zettelkatalog bis auf Stufe Archiveinheit:
4’90 Departement allgemein
4'900 Manuale 1907-1973
4'901 Kopierbücher 1907-1927
4'902 Allgemeine Akten 1907-1972
4'903 Jahresberichte 1843-1906
4'906 Allgemeines-Personelles-Gesetzgebung 1846-1948
4'908 Forstdirektorenkonferenz 1935-1961
4’91 Kantonsforstamt, allgemein
4'910 Protokolle 1846-1870
4'911 Manuale 1865-1919
4'912 Allgemeine Akten 1843-1906
4'913 Tagebücher 1909-1936
4'914 Gemeinde- & Korporationswaldungen: Allg. Akten 1806-1920
4'915 Gem.- & Korporationswaldungen: Inspektionsberichte 1861-1906
4'916 Gem.- & Korporationswaldungen: Waldreglemente/WP 1860-1970
4'917 Gem.- & Korporationswaldungen: Waldverkäufe 1912-
4'918 Gem.- & Korporationswaldungen: Rodungen 1866-1906
4'919 Gem.- & Korporationswaldungen: Pers.-Verzeichnisse 1842-1907
4’92 Kantonsforstamt, Finanzielles
4'920 Forstrechnungen, Waldertrag 1846-1937
4'921 Revisionsbemerkungen 1847-1856
4'923 Bundesbeiträge an Besoldungen des Forstpersonals 1892-1940
4'924 Hauungs- und Kulturvorschläge sowie –nachweise 1847-1901
4'925 Forstreservekasse 1941-
4'926 Tabellen und Zusammenstellungen 1845-
4'929 Förderung der Holzforschung 1946-1955
4’93 Fischerei
4'930 Manuale 1936-1959
4'931 Allgemeine Akten 1805-1959
4'932 Allgemeines-Personelles-Gesetzgebung 1875-
4'933 Fischereiaufsicht 1890-
4'934 Akten Bodensee 1873-1910
4'935 Akten Untersee 1517-1897
4'936 Flussfischerei 1820-1930
4'937 Fischzucht 1877-19514'938 Vogeljagd 1897-1957
4'939 Verunreinigung der Gewässer 1887-
Bereits der oben aufgeführte Auszug der Beständeübersicht liess verschiedene Eckdaten bei den Aktenreihen erahnen, die für die Neuerschliessung taktgebend waren: beispielsweise 1843, 1906/1907 und 1937. Sie waren Indikatoren für die organisatorischen Umbrüche, die in der bisherigen Beständegliederung nur unzureichend zum Ausdruck kamen. Organisatorisch waren die beiden Aufgabengebiete „Forstwesen“ und „Fischereiangelegenheiten“ bis 1906 getrennt. Beide Aufgabengebiete wurden zuerst im Nebenamt ausgeführt und erst nach einer personellen Aufstockung organisatorisch verankert (Professionalisierung). Beim Forstwesen war dies 1842, bei den Fischereiangelegenheiten ab 1890 (Bestellung zweier Fischereiaufseher) beziehungsweise 1907. Zwischen 1907 und 1936 wurden sie zusammen im Forst- und Fischereidepartement verwaltet. Nach dem organisatorischen Konglomerat wurden die Fischereiangelegenheiten 1937 in einem separaten Fischereidepartement behandelt, das 1976 aufgelöst beziehungsweise dem Jagd- und Fischereidepartement zugeschlagen wurde. Für die Kontextualisierung der Akten, dem Verständnis des Bestands und somit auch für dessen Benutzung waren diese Phasen entscheidend, so dass sich folgende Hauptfonds herauskristallisierten:
4'90-4'93 Forst, Fischerei 1804-
4'90 Forstwesen, Fischereiwesen 1805-1906
4'91 Forst- und Fischereidepartement 1907-1936
4'92 Forstdepartement 1937-1990
4'93 Fischereidepartement 1937-1976
Folgende Grundsatzentscheide für die Neuberabeitung des Bestands wurden getroffen: die Beibehaltung der vier Hauptsignaturenreihen, allerdings wurden diese neu benannt; Beibehaltung der Trennung der beiden Ressorts Forst und Fischerei; Einführung einer Periodizität nach dem Prinzip des Akzessionsarchivs zum besseren Verständnis der organisatorischen Entwicklung und als Vorgabe für die folgenden 9er Bestände des "Kantonsforstamts 1991-" sowie der "Jagd- und Fischereiverwaltung 1977-"; Feststellung der Akten und Aktenproduzenten (Akzentuierung der Provenienzen); Orientierung an der Registratur im Amt und nicht an der Erstbearbeitung im Staatsarchiv; gänzliche Neubearbeitung unter Weglassung der Altsignatur(en); Verzeichnung auf Stufe Dossier.
(Weiterführende Bemerkungen im Feld Kommentar) |
|
Zugangs- und Benutzungsbedingungen: |
| Rechtsstatus: | Eigentum des Staatsarchivs des Kantons Thurgau. |
| Zitiervorschlag: | Fussnote: StATG 4'9*, */*
Quellenverzeichnis: StATG 4'90-93 Forst 1803-1990, Fischerei 1803-1976
|
| Sprachen: | Deutsch |
| Finding aids: | Werden im Bestand ausgewiesen. |
|
Sachverwandte Unterlagen: |
| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | StATG 4'237’0-3 Entsumpfungen 1835-1908
StATG 4’39 Klosterverwaltung-, -aufhebung und –liquidation 1799-1919
StATG 4'530’0-4 Jagd- und Fischereipolizei 1804-1981
StATG 4'602 Freyenmuth Johann Conrad (1775-1843), Regierungsrat
StATG 4'621 Schwyter Joseph Anton (1840-1927), Kantonsforstmeister
StATG 8'685 Egloff Johann Conrad (1808-1886), Regierungsrat
StATG 8'908 Thurgauische Naturforschende Gesellschaft 1854-2001
StATG 8'909 Gesellschaft zur Erhaltung des Schweizerischen Bodensee-Schongebietes
StATG 8'928 Initiativkomitee gegen die Wasservogeljagd 1979-1986
StATG Slg. 8.1 Straub Walter (1901-1991), Kantonsforstmeister
StATG Slg. 8.1 Hagen Clemens (1926-1990), Kantonsforstmeister |
| Veröffentlichungen: | Darstellungen zum Bestand:
Guggisberg, Ernst: Die Nach-Erschliessung von Beständen unter archivethischer und konservatorischer Betrachtung: Das Thurgauer Forst- und Fischereiwesen. Hausarbeit des Weiterbildungsprogramms in Archiv-,
Bibliotheks- und Informationswissenschaften der Philosophisch-historischen Fakultät der Universität Bern, Frauenfeld 11.2013 (Typoskript).
Jacobi, Verena; Pfaffhauser, Paul: Thurgauer Forstakten 1803-1950 (Typoskript).
Darstellungen über das Thurgauer Forst- und Fischereiwesen:
Forstamt des Kantons Thurgau: Der Forstdienst im Kanton Thurgau. Festschrift 100 Jahre Thurgauer Försterverband / Verband Thurgauer Forstpersonal 1909-2009, Schönenberg: DKD AG – Druck-Kommunikation-Design 2009.
Hagen, Clemens: Wie die thurgauische Forstorganisation entstand, in: TJb 1970, S. 32–44.
Hagen, Clemens: Ergebnisse der Forsteinrichtung im Kanton Thurgau. In: Thurgauer Bauer. Obligatorisches Organ des Thurgauischen Landwirtschaftlichen Kantonalverbandes, 102. Jg, Nr. 47, 19.11.1955, S. 2083-2090.
Hagen, Clemens: Die Entwicklung des Waldeigentums im Thurgau. In: Thurgauer Jahrbuch 1970 (Jg. 45), Frauenfeld: Verlag Huber & Co. AG, S. 16-31.
Hagen, Clemens: Wie die thurgauische Forstorganisation entstand. In: Thurgauer Jahrbuch 1970 (Jg. 45), Frauenfeld: Verlag Huber & Co. AG, S. 32-44.
Hagen, Clemens: Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, in: Wirtschaftsgeschichte des Kantons Thurgau. Festgabe zum hundertjährigen Bestehen der Thurgauischen Kantonalbank 1871-1971, Albert Schoop (Hrg.), Weinfelden 1971, S. 105-119.
Hagen, Clemens: Die ersten Forst-Akademiker im Kanton Thurgau, in: Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen 123 (1972), S. 461–472.
Hagen, Clemens; Pfaffhauser, Paul; Krämer, Augustin: Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, in: Albert Schoop u. a.: Geschichte des Kantons Thurgau, Bd. 2: Sachgebiete I, Frauenfeld 1992, S. 215–242.
Kunz, Richard: Fischereirechte im Untersee und Seerhein. Eine rechtshistorische Untersuchung über die Entstehung, Ausbildung und Weiterentwicklung von Fischereirechten, Diss. iur. (Fribourg), Zürich 19
Pfaffhauser, Paul: Zur Geschichte des Forstdepartementes, Faltblatt, Frauenfeld 1990.
[Pfaffhauser, Paul]: 1842–1992. Vor 150 Jahren entstand der Thurgauer Forstdienst, in: Jahrbuch der Thurgauer Waldwirtschaft 1992, S. 35–45.
Pfaffhauser, Paul: 1842-1992 Vor 150 Jahren entstand der Thurgauer Forstdienst, in: Jahrbuch der Thurgauer Waldwirtschaft 1992, Forstamt des Kantons Thurgau (Hrg.), [Frauenfeld: Selbstverlag?] 07.1993, S. 35-46.
Pfaffhauser, Paul: Die Entstehung und Entwicklung des Forstdienstes. In: Der Forstdienst im Kanton Thurgau. Festschrift 100 Jahre Thurgauer Försterverband / Verband Thurgauer Forstpersonal 1909-2009, Forstamt des Kantons Thurgau (Hrg.), Schönenberg: DKD AG – Druck-Kommunikation-Design 2009, S. 5-86.
Pupikofer, Johann Adam: Der Kanton Thurgau, historisch, geographisch, statistisch geschildert. Beschreibung aller in demselben befindlichen Berge, Seen, Flüsse, Heilquellen, Städte, Flecken, Dörfer, so wie der Schlösser, Burgen und Klöster; nebst Anweisung denselben auf die genussvollste und nützlichste Weise zu bereisen; Ein Hand- und Hausbuch für Kantonsbürger und Reisende, In: Historisch-geographisch-statistisches Gemälde der Schweiz, 17. Heft, St. Gallen/Bern 1837.
Stähelin, Willy: Wo stehen wir heute in der thurgauischen Forstgeschichte?, in: Thurgauer Bauer. Obligatorisches Organ des Thurgauischen Landwirtschaftlichen Kantonalverbandes, 102. Jg, Nr. 47, 19.11.1955, S. 2045-2050.
Straub, Walter: Zehnjährige Praxis mit der kant. Vollziehungsverordnung zum eidgenössischen Forstgesetz vom 16. Juli 1945, in: Thurgauer Bauer. Obligatorisches Organ des Thurgauischen Landwirtschaftlichen Kantonalverbandes, 102. Jg, Nr. 47, 19.11.1955, S. 2051-2069. |
|
Anmerkungen |
| Kommentar des Staatsarchivs: | Fortsetzung Ordnung und Klassifikation: Bei der Neubearbeitung richtete der Archivar den Fokus auf die verschiedenen organisatorischen Phasen und deren institutionellen Niederschlag (in Anlehnung beispielsweise ans Departementsarchiv Armenwesen 4’94-4’96). Grundsätzlich liessen sich vier Phasen beobachten: 1. eine nicht-institutionelle, nebenamtliche Führung der Regale Forst und Fischerei durch die Kommissionen bzw. Departemente und deren Vorsteher; 2. die Professionalisierung mit Schaffung von Vollzeitbeamten und einer eigenen Verwaltungsstruktur (traf nur auf die Forstverwaltung zu, die Fischereiangelegenheiten wurden in Teilzeit von zwei Fischereiaufsehern unter direkter Aufsicht des Regierungsrats erledigt); 3. die organisatorische Zusammenfassung der Forstverwaltung und der Fischereiangelegenheiten und 4. die organisatorische Trennung der beiden Ressorts:
4’90 Forstwesen, Fischereiwesen 1805-1906
4'900 Forstwesen 1806-1842
4'901 Forstverwaltung 1842-1906
4'902 Fischereiwesen 1805-1906
4’91 Forst- und Fischereidepartement 1907-1936
4’910 Departementsleitung 1907-1936
4'911 Forstwesen 1907-1936
4'912 Fischereiwesen 1907-1936
4’92 Forstdepartement 1937-1990
4'920 Forstwesen 1937-1990
4’93 Fischereidepartement 1937-1976
4'930 Fischereiwesen 1937-1976
Folgebstände in der Hauptabteilung 9 Akzessionsarchiv:
9’24 Kantonsforstamt 1991-2000
9’** Jagd- und Fischereiverwaltung 1977-
Unterhalb der pseudo-provenienten Hauptfonds wurden für die Signaturenreihen 4’90, 4’91 und 4’93 jeweils zwei Fonds „Forst“ und „Fischerei“ geführt, im Falle 4’92 drei Fonds mit „Departementsleitung“, „Forst“ und „Fischerei“. Der Vorteil dieser pertinenten Auftrennung lag darin, dass die vorher und nachher getrennten Sachbereiche nicht vermischt wurden und insbesondere durch einen sauberen chronologischen und thematischen Schnitt durch zukünftige 9er-Bestände (Kantonsforstamt, Jagd- und Fischereiverwaltung) abgelöst werden können: Im Falle des Forstwesens mit dem Kantonsforstamt ab 1991, im Falle der Fischereiangelegenheiten mit der Jagd- und Fischereiverwaltung ab 1976.
Eine Erläuterung zur Verwendung des Departementsbegriffs in der Bestandsgliederung: In der Verwaltung wird der Begriff Departement (meist mit einem Departementssekretariat) allgemein als organisatorischer Überbau mehrerer untergeordneter Ämter verstanden. Im vorliegenden Bestand und den darin enthaltenen Quellen wird der Begriff fast inflationär und mitunter als Synonym für ein „Amt“ verwendet. Zwischen 1804 und 1906 wird deshalb im Bestand immer von der vorgesetzten Behörde gesprochen. Zwischen 1906 und 1936 war das „Forst- und Fischereidepartement“ zugleich Departement und Amt, anschliessend wurden die beiden Sachgebiete Forst und Fischerei in eigenen sogenannten Departementen verwaltet, wobei dieselben faktisch nichts anderes als Ämter darstellten. Dennoch muss die Bezeichnung Departement beibehalten werden, da diese durchgehend in den Quellen verwendet wird.
Mit oben vorgestellter Beständegliederung wurde der zeitgemässe Ansatz der Gesamtablieferungen aufgegriffen und das Provenienzprinzip stärker akzentuiert. Problematisch wurde der Vorschlag bezüglich Übersichtlichkeit in den auf die Hauptfonds folgenden Hierarchiestufen der Fonds. Mit dem Signaturensystem, wie es beispielsweise bei der Kriegswirtschaft 4’14* angewandt wurde und der „Verdoppelung der Fonds“ unter Auslassung der Archiveinheit, konnte allerdings eine weitere Gliederungsebene hineingebracht werden.
|
| Bei der Neubearbeitung des Bestands wurde der Archivar mit folgenden Fragen konfrontiert: Inwiefern sollte in die Erstbearbeitung eingegriffen werden und inwiefern bot eine provenient ausgerichtete Neuverzeichnung Transparenz? Wie stark sollte in die Dossierbildung der Erstverzeichnung eingegriffen werden, waren beide Eingriffe doch interpretativ? Inwiefern war eine aufwändige Umordnung betriebsökonomisch vertretbar? Aufgrund der Bestandsautopsie kristallisierten sich folgende Fragestellungen und Beschlüsse heraus:
1. Die älteste Reihe der Forstprotokolle mit dazugehörigen Sitzungsakten wurden bei der Erstverzeichnung thematisch aufgeteilt, der Entstehungszusammenhang und die Authentizität der Akten wurden weitgehend vernichtet. Da die Sitzungsunterlagen Aktenzeichen aufwiesen, konnte eine Rückordnung teilweise erfolgen. Eine Überprüfung auf Vollständigkeit blieb allerdings müssig.
2. Die Reihe der „Allgemeinen Akten des Forst- und Fischereidepartement“ wurde bei der Erstbearbeitung nicht verändert. Zur Diskussion wurde allerdings die Erschliessungstiefe gestellt: Bei der Erstverzeichnung wurden die Akten auf Stufe Archiveinheit erschlossen – dieselbe fiel beim oben angedachten Signaturensystem allerdings weg. Die Allgemeinen Akten des Forst- und Fischereidepartements wurden folgendermassen erschlossen: 1907-1936 in „Archiveinheiten“ (Fonds 2. Stufe) mit den tadellos geführten Manualen als Findhilfsmittel, ab 1936 auf Dossierstufe.
3. Die Wirtschaftsplanakten aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lagen in einigen Fällen auch als ungebundene Akten vor. Da eine Ordnung nach Zeitabschnitten und innerhalb dieser nach alphabetischer Folge geplant war, mussten dieselben wie die übrigen gebundenen Waldwirtschaftspläne stehend archiviert werden. Die Loseblattablage „Vorarbeiten zu Waldwirtschaftsplänen“ wurde als separate Aktenreihe liegend archiviert.
4. Unter der Aktenreihe „Projektakten“ wurden in der Erstbearbeitung die Unterlagen seit Gründung der Staatsforstverwaltung in den Bereichen Strassen- und Wegprojekte, Güter- und Waldzusammenlegungen und Bachverbauungen zusammengefasst und chronologisch abgelegt. Für den Zeitraum 1843 bis 1865 bediente man sich bei der Ersterschliessung auch aus den Sitzungsunterlagen (eigentlich den Protokollen zugehörig), um eine durchgehende Reihe zu erhalten. Der Vorschlag des bearbeitenden Archivars bei der Neuerschliessung ging dahin, dass Akten, die den Sitzungsunterlagen zugeordnet werden konnten, rückplatziert werden sollten. Die sonstige chronologische und mehrere Projekttypen umfassende Ablage sollte aufgrund ihres Umfangs so belassen werden, eine Aufnahme der Projektart (Thesaurus) in den Titel schuf Übersichtlichkeit. In den Dossiers kommen gefaltete Pläne vor. Gemäss der Praxis des Staatsarchivs wurden dieselben so belassen und nicht als Selekten plan gelegt.
5. Die forstpolizeilichen Unterlagen wie Bewilligungen zu Holzschlag, Rodungen und Urbarisierungen wurden mit den Forstfrevelregistern zusammen als Aktenreihe abgelegt. Hier konnte bereits die Bildung von Zeitschnitten Transparenz schaffen. Die Forstfrevelregister 1850-1875 wurden bei der Erstbearbeitung wie die Hauungsvorschläge aus ihren Einbänden geschnitten und passend in Archivschachteln gefaltet. Bei der Neubearbeitung wurde diese unsachgemässe Handhabe nach Möglichkeit rückgängig gemacht. Bei den Schlagbewilligungen zwischen 1937 und 1950 existieren Verzeichnisse nach Gesuchsteller, die mit den Akten korrespondieren.
6. Die Aktenreihe „Jahresberichte und Daueraufträge“ der Erstbearbeitung umfassten Jahresberichte der Forstkreisingenieure, des Kantonsförsters an das übergeordnete Departement sowie Mitarbeiten in Gremien. Diese Aktenreihe musste der Transparenz halber aufgetrennt werden.
|
| 7. Die Serie „Krisenzeiten“ war höchst pertinent und vermischte reines Dokumentationsmaterial mit Korrespondenzunterlagen. Bei der Neubearbeitung musste die Serie aufgetrennt und neu zugeordnet werden. Dies war vertretbar, da die Dossierbildung der Erstverzeichnung eine reine Einzelblattzuweisung zu sein schien. Wiederherstellungsprojekte nach Sturmschäden konnten beispielsweise bei den Projektakten abgelegt werden.
8. Die Titelgebung der sogenannten Manuale ab 1869 (zu denen keine Allgemeinen Akten korrespondierten) war sehr missverständlich. Bei dieser Serie handelte es sich um Arbeitsjournale des Forstmeisters des I. Kreises, die auch eine Art Copie de lettres waren. Diese Reihe wurde auch im III. Kreis ab 1909 geführt. Hier sollte die Titelgebung und die Verortung im Bereich der Amtsleitung Klarheit schaffen.
Verzeichnisse:
Staatsforstverwaltung, Kantonsforstamt, Forstamt:
Forstkreisorganisation: Bis 1907 zwei, ab 1908 drei, ab 1946 vier, ab 1959 fünf Forstkreise:
Forstkreis I bis 1944/46: Bezirk Frauenfeld und vom Bezirk Münchwilen die Munizipalgemeinden Bichelsee, Fischingen und Sirnach
Forstkreis I 1944-2005: Bezirk Frauenfeld
Forstkreis II bis 1945: Bezirke Arbon, Bischofszell, Kreuzlingen, Weinfelden; vom Bezirk Münchwilen die Munzipalgemeinden Affeltrangen, Tobel, Lommis Wängi, Rickenbach, Wuppenau und Schönholzerswilen; vom Bezirk Steckborn die Munizipalgemeinden Müllheim und Pfyn
Forstkreis II 1946-2001: Bezirk Münchwilen sowie vom Bezirk Steckborn die Munizipalgemeinden Müllheim und Pfyn
Forstkreis III 1908-1990: Bezirk Diessenhofen sowie Bezirk Steckborn ohne die Munizipalgemeinden Müllheim und Pfyn
Forstkreis IV 1946-1959: Bezirke Arbon, Bischofszell, Kreuzlingen und Weinfelden
Forstkreis IV 1959-1991: Bezirke Arbon, Bischofszell und Kreuzlingen
Forstkreis V 1959-1991: Bezirk Weinfelden
Forstmeister, ab 1866 Kantonsforstmeister, ab 1996 Kantonsforstingenieur:
Stähelin Johannes 1842-1866
Schwyter Anton 1866-1919
Schwyter Paul Anton 1919-1944
Straub Walter 1944-1967
Hagen Clemens 1967-1990
Kreisforstmeister, ab 1996 Kreisforstingenieure:
Forstkreis I
Schwyter Anton 1908-1919 (Teilzeit neben Kantonsforstmeister)
Schwyter Paul Anton 1919-1944 (Teilzeit neben Kantonsforstmeister)
Straub Walter 1944-1946 (Teilzeit neben Kantonsforstmeister)
Forstkreis I
Straub Walter 1944-1946 (Teilzeit neben Kantonsforstmeister)
Hagen Clemens 1967-1984 (bis 1984 Teilzeit neben Kantonsforstmeister)
Bont Armin 1984-2005
Forstkreis II
Fischer Jakob 1908-1946
Krebs Fritz 1946-1974
Rieder Martin 1974-2001
Forstkreis III
Etter Paul 1908-1936
Altwegg Paul 1936-1959
Gemperli Linus 1959-1990
Forstkreis IV
Fischer Jakob 1946-1949
Ulmer Ernst 1949-1959
Forstkreis IV
Ulmer Ernst 1959-1984
Nussbaumer Hans 1984-1991
Forstkreis V
Hagen Clemens 1959-1967
Hugentobler Urs 1967-1991
|
| Fischereiangelegenheiten, Fischereidepartement:
Fischereikreisorganisation: zwischen 1890 und 1906 zwei, ab 1907 vier Fischereikreise:
Kreis I: Unterseegebiet und Oberseegebiet des Bezirks Kreuzlingen 1890-1976
Kreis II: Oberseegebiet des Bezirks Arbon 1890-1976
Kreis III: Murg nebst Zuflüssen 1907-1976
Kreis IV: Thur und Sitter nebst Zuflüssen 1907-1976
Fischereiaufseher:
Kreis I
Marx Ribi, Ermatingen 1892-1897
Konrad Ribi, Ermatingen 1898-1940
Adolf Läubli, Ermatingen 1941-1953/1956
Hans Ribi-Honz, Ermatingen 1953/1956-1976
Kreis II
Wilhelm Schweizer, Romanshorn 1892-1931/1932
Walter Annasohn, Uttwil 1931/1932-1956/1959
Hans Gügi, Romanshorn 1956/1959-1973
Erwin Fischer, Salmsach 1973-1976
Kreis III
Robert Heitz, Münchwilen 1907-1910
Kreis IV
H. Debrunner, Felben 1907-1910
Kreis III und IV (Personalunion)
E. Debrunner, Felben 1910/1912-1918
Hermann Meier, Felben 1919-1959/1962
Werner Meier, Felben 1959/1962-1965/1968
Max Brenner, Märstetten 1965/1968-1976 |
|
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/2010 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | uneingeschränkt |
| Accessibility: | Oeffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: |  https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=188240 https://query-staatsarchiv.tg.ch/detail.aspx?ID=188240 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |
|